Die Flutwellen waren zwischen fünfzehn und dreissig Metern hoch. Ihre zerstörerische Wucht reichte mehrere Kilometer ins Land hinein, riss Häuser, Autos, Menschen mit sich. Der Tsunami im Jahr 2004, ausgelöst durch ein Erdbeben der Stärke 9,1 im Indischen Ozean, wurde zu einer der grössten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Etwa 280’000 Menschen verloren ihr Leben. Und 1,7 Millionen Menschen in insgesamt 13 Ländern waren auf einen Schlag obdachlos.
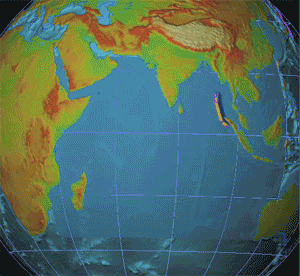
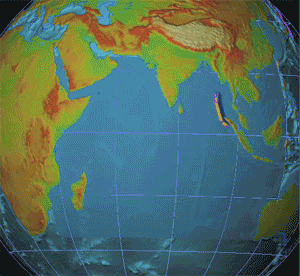
Epizentrum des Erdbebens und Ausbreitung des Tsunamis
Heute stehen viele der zerstörten Häuser wieder – dank der grossen Solidarität von Menschen und Ländern rund um den Globus. Sie haben mit Spenden den Wiederaufbau finanziert. Allein die Schweizer Glückskette sammelte in den Wochen nach der Katastrophe 227 Millionen Franken. Die Sammelaktion bleibt bis heute die erfolgreichste der Schweizer Geschichte. Dank der Spenden haben heute etwa 18’000 Familien in den betroffenen Gebieten wieder ein Dach über dem Kopf. Und zwar meistens genau dort, wo ihr Haus vor der Katastrophe stand: an der Küste.
«Build back better» nennt sich dieses Prinzip, an das sich die meisten Hilfswerke halten. Die Häuser der Betroffenen werden an Ort und Stelle wiederaufgebaut, jedoch besser gegen die Naturgewalten gewappnet. Nach einem Hochwasser etwa werden die Häuser auf Pfähle gebaut, und nach einem Erdrutsch durch Schutzwälle gesichert. So soll der Schaden und das Leid im Fall einer erneuten Naturkatastrophe in Grenzen gehalten werden.
Die Schwächsten trifft es am härtesten
Ausgerechnet die Schwächsten der Gesellschaft können jedoch bei diesem gut gemeinten Prinzip die Verlierer sein. Das zeigt eine neue Studie der ETH Zürich, die die langfristigen Folgen des Wiederaufbaus in der indonesischen Küstenstadt Banda Aceh untersuchte.
«Die Entscheidung, die Häuser an Ort und Stelle wiederaufzubauen, führte zu einer Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich», sagt Jamie McCaughey, Umweltsozialwissenschaftler und Autor der Studie. Denn schon während des Wiederaufbaus begann eine verhängnisvolle Preisspirale. Reiche Familien begannen, ihre wiederaufgebauten Häuser an der Küste zu vermieten, und zogen ins Landesinnere – weg von der Gefahrenzone. Fast niemand will mehr an der Küste leben, denn gegen die Wassermassen eines Tsunami schützt keine bauliche Massnahme. Dadurch entwerteten sich die Häuser und Grundstücke an der Küste immer weiter, während diejenigen im Landesinnern an Wert gewannen. So waren die armen Familien gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben, weil sie sich den Umzug nicht leisten konnten. «Arme Menschen tragen deshalb heute das höchste Katastrophenrisiko», sagt McCaughey. Sollte wieder einmal ein Tsunami die Region Banda Aceh überschwemmen, wird es dieses Mal vor allem arme Leute treffen. Für seine Studie arbeitete McCaughey zusammen mit Kollegen von Universitäten aus Indonesien und Singapur. In den Jahren 2014 und 2015 – also zehn Jahre nach der Katastrophe – befragten die Forscher sowohl Menschen, die den Tsunami überlebt hatten, wie auch solche, die neu in die Stadt gezogen waren, zudem Gemeindevorsteher und die indonesische Regierung.
Vor dem Tsunami sei die Bevölkerung noch gut durchmischt gewesen, sagt McCaughey. «Das Risiko eines Tsunamis von diesem Ausmass war den Leuten einfach nicht bewusst.» Doch mit der Katastrophe habe sich das schlagartig geändert, und so begann der Teufelskreis. Diese Spaltung der Gesellschaft hätte vielleicht verhindert werden können, findet der Forscher. «Man hätte vor dem Wiederaufbau den Leuten die Wahl lassen müssen, ob sie bleiben oder wegziehen wollen.»
Auf das Helfen warten
Doch hätten die Hilfswerke überhaupt eine andere Möglichkeit gehabt? «Nur sehr eingeschränkt», sagt Ernst Lüber, Leiter der Projektabteilung bei der Schweizer Glückskette. Die Situation nach einer Katastrophe sei meist komplex und chaotisch. «In den ersten Wochen geht es ums pure Überleben», sagt Lüber. Die Menschen brauchen Wasser, Essen, und einfache Baumaterialien wie Wellbleche, um sich eine vorübergehende Notunterkunft zu bauen.
Der eigentliche Wiederaufbau startet erst später. «Wir sind abhängig von den lokalen Regierungen», sagt Lüber. Erst wenn die Behörden Richtlinien erlassen haben, wie der Wiederaufbau zu erfolgen hat, können die Hilfswerke aktiv werden. Das kann sich manchmal hinziehen. Beispielsweise nach den schweren Erdbeben in Nepal, die im April und Mai 2015 über 800’000 Häuser zum Einsturz brachten. Sommer und Herbst verstrichen, ohne dass der Wiederaufbau begann, weil die Regierung keine Richtlinien dazu herausgegeben hatte. «Wir waren komplett blockiert», sagt Lüber. «Der Winter kam und die Leute hatten kein Dach über dem Kopf. Wir standen da mit unserem Geld und konnten nichts tun.» Das sei gegenüber den Spendern in der Schweiz schwer zu kommunizieren.
Umsiedlungsplan verworfen
Im Fall des Tsunami habe die indonesische Regierung ursprünglich tatsächlich den Plan gehabt, den betroffenen Menschen die Wahl zu lassen, ob sie bleiben oder wegziehen wollen, sagt der ETH-Forscher Jamie McCaughey. So hätten Handwerker oder Markthändler wohl den Wegzug gewählt, Fischer dagegen wären eher an der Küste geblieben, um ihre Arbeit nicht zu verlieren. «Doch dann kam alles anders», sagt der Soziologe. Weshalb, sei im Nachhinein schwierig zu sagen. Fest steht: «Auf der Regierung lastete ein riesiger Druck, möglichst rasch mit dem Wiederaufbau zu beginnen.» Dieser Druck komme aus allen Richtungen: Die Leute wollen rasch in ihre Häuser zurückkehren, die Politik will endlich etwas bewegen, und die privaten Spender rund um die Welt wollen sehen, wie ihr Geld hilft.
Um möglichst effiziente Hilfe zu leisten, arbeitet die Glückskette daher mit anderen Schweizer Hilfswerken zusammen, die lokal gut vernetzt sind. Sie kennen die Kultur, die Politik, die Behörden und Gesetze der Region. Und schlagen konkrete Wiederaufbaumassnahmen vor, die sich an die Richtlinien der Regierung halten. Die Glückskette entscheidet dann, welche Projekte sie finanzieren will und welche nicht. «Das gibt uns zwar schon einen gewissen Einfluss auf die Art des Wiederaufbaus», sagt Lüber. «Doch an die Vorgaben der Regierungen müssen wir uns natürlich halten.» Und trotz aller Hilfe, die er durch die Glückskette leisten kann, bleibt für Lüber ein Wermutstropfen. Denn in einem Punkt vermag auch die Glückskette nicht viel zu bewegen: «Meistens bleiben die Armen arm, und die Reichen werden reicher.»




























