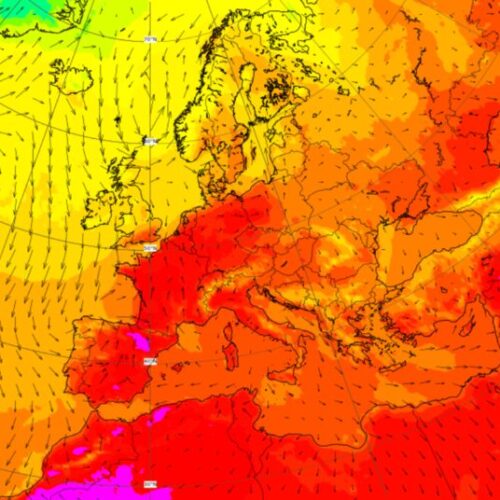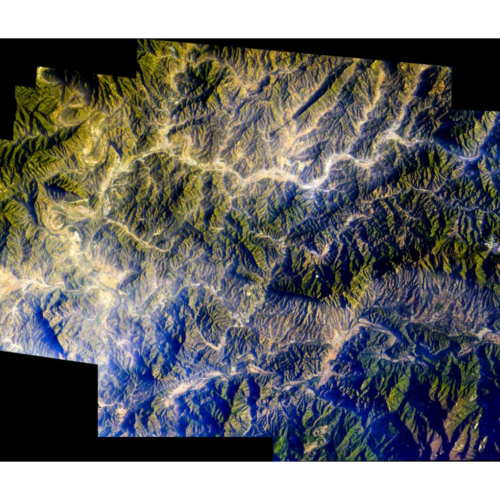Das musst du wissen
- Viele soziale Tierarten haben Verhaltensweisen entwickelt, um Epidemien in ihren Gruppen und Kolonien zu verhindern.
- Sie praktizieren soziale Distanzierung, Selbstisolation und selbst «Risikogruppen» verhalten sich anders.
- Diese Verhaltensweisen haben aber auch Nachteile, etwa für die Nahrungssuche oder das Überleben.
«Social Distancing» ist ein Begriff, der uns in den letzten Monaten sehr vertraut geworden ist. Die Veränderungen, die das Coronavirus in unseren Beziehungen zu anderen Menschen bewirkt, sind manchmal schwer zu akzeptieren und wirken unnatürlich. Und doch! In der Natur praktizieren vielen sozialen Tierarten bei Epidemien eine Form der sozialen Distanzierung – von Insekten bis hin zu Säugetieren. Dies geht aus einem Artikel hervor, der am 12. August in den «Proceedings of the Royal Society B» veröffentlicht wurde.
Warum das wichtig ist. Das Gruppenleben hat sich wahrscheinlich entwickelt, weil es den Tieren Vorteile bietet: So können sie grössere Beute jagen, Gefahren besser erkennen, ihr Territorium gemeinsam verteidigen, sich gegenseitig vor Raubtieren schützen oder sich gegenseitig warmhalten. Doch das Zusammenleben mit anderen hat einen grossen Nachteil: Krankheitserreger übertragen sich leichter. Aus diesem Risiko hätte sich eigentlich ein Verhalten entwickelt, das eine Ansteckung verhindert.
Risiko erkennen. Um ihr Verhalten an eine riskante Gesundheitssituation anzupassen, müssen die Tiere vor allem erkennen, wenn eine Krankheit grassiert. Um zum Beispiel kranke Mitglieder ihrer Gruppen zu identifizieren, sind Tiere auf Veränderungen im Verhalten oder im Aussehen angewiesen:
- Guppy-Fische etwa meiden Artgenossen, die sich in einem lethargischen Zustand befinden.
- Schimpansen halten Abstand zu Artgenossen, deren körperliche Erscheinung sich verändert hat. So meiden sie jene Tiere, die an Polio erkrankt sind, einer ansteckenden Krankheit, die die Gliedmassen deformiert.
Andere Tiere sind in der Lage, die Krankheit bereits zu bemerken, bevor sichtbare Symptome auftreten:
- Die Karibik-Languste verwendet chemische Signale, um diejenigen in ihrer Gruppe zu identifizieren, die mit dem hochansteckenden und tödlichen PaV1-Virus infiziert sind. Der Urin von erkrankten Tieren verströmt einen besonderen Geruch, den gesunde Langusten schon frühzeitig im Krankheitsverlauf wahrnehmen.
- Die «Amerikanische Faulbrut» ist eine hochansteckende Bienenkrankheit, die alle Larven eines Volkes zerstören kann. Adulte Bienen nehmen den eigentümlichen Geruch wahr, den die kontaminierten Larven abgeben, und entfernen diese aus der Kolonie.


Karibik-Langusten erkennen am PaV1-Virus erkrankte Artgenossen am Geruch des Urins.
Anpassung des Sozialverhaltens. Das Distanzverhalten variiert von Spezies zu Spezies und reicht von totaler Isolation bis zu einer feineren Anpassung der sozialen Interaktionen.
Zum Beispiel beginnt die Fledermaus Myotis Lucifugus, einzeln zu nisten, wenn ein schädlicher Pilz in der Kolonie ausbricht, anstatt sich wie gewöhnlich zusammen zu gruppieren. Das Gleiche gilt für die Kabribik-Languste, wo sich einzelne Tiere eigene Höhlen suchen, wenn sich normalerweise mehr als zwanzig von ihnen in einem einzigen Unterschlupf aufhalten. Diese Verhaltensweisen sind nicht auf erwachsene Tiere beschränkt: Beim Ochsenfrosch sind es die Kaulquappen, die die Kranken erkennen und ihnen ausweichen.


Sobald ein Pilz in einer Kolonie der Fledermaus Myotis Lucifgus ausbricht, nisten die Fledermäuse alleine statt wie üblich in der Gruppe.
Bei einigen Arten ist die soziale Distanzierung viel gezielter. Mandrill-Affen erkennen Artgenossen, die von Darmparasiten befallen sind, am Geruch. Sie vermeiden es, diese zu entlausen, es sei denn, sie sind enge Verwandte. In diesem Fall schlagen sie alle Sorgen in den Wind. Biologen gehen davon aus, dass die Verbindungen zwischen Verwandten zu wichtig sind, um sie nicht um jeden Preis aufrechtzuerhalten.
Ähnlich ist es bei den Vampirfledermäusen, die ihr Verhalten anpassen, je nachdem, was mit ihren Artgenossen los ist: Im Falle einer Epidemie ist die Pflege nur den Familienmitgliedern vorbehalten.
Risikogruppen. Diejenigen Tiere, die am meisten gefährdet sind, sind möglicherweise vorsichtiger in Bezug auf das Kontaminationsrisiko, wie bei mehreren Arten beobachtet wurde.
- Beispielsweise schränken Guppy-Fische, die körperlich weniger fit sind, ihre Interaktionen mit parasitierten Artgenossen stärker ein als gesunde.
- Ähnlich bei Finken: Diejenigen Tiere mit einem schwachen Immunsystem vermeiden Artgenossen, die krank oder lethargisch wirken.


Guppys meiden den Kontakt mit anderen Guppys, die sich lethargisch verhalten.
Die am meisten gefährdeten Tiere sind möglicherweise auch besser durch den Rest der Kolonie geschützt. Zum Beispiel bei den Schwarzen Wegameisen: Sie bringen Eier und Larvenpuppen sofort in Sicherheit, wenn eine Krankheit ausbricht. Sie sorgen dafür, dass die Brut in die Nähe des Zentrums des Ameisenhaufens kommt, weg von den infizierten Ameisen.
Selbstisolation. Während gesunde Tiere erkrankte oft meiden, gilt das Umgekehrte ebenfalls: Kranke können sich selbst isolieren. Forscher haben dies bei sozialen Insekten beobachtet, bei denen das Interesse der Kolonie oft Vorrang vor individuellen Interessen hat:
- Wenn bei Honigbienen eine Arbeitsbiene von der Varroamilbe befallen ist, verlässt sie ihr Bienenvolk von sich aus.
- Wenn eine Schwarze Wegameise mit einem tödlichen Pilz infiziert ist, beginnt sie, mehr Zeit im Freien zu verbringen, weg vom Ameisenhaufen.
Die Folgen. Das «Social Distancing» bei Tieren ist aber auch mit Nachteilen verbunden. Durch die Verringerung ihrer sozialen Interaktionen berauben sich die Tiere selbst eines nützlichen Teils des Gruppenlebens.
Für die Langusten, zum Beispiel, birgt das Abstandhalten ein höheres Risiko gefressen zu werden. Denn nur in Gruppen können sie sich gegen Raubfische wehren. Fledermäuse der Art Myotis Lucifugus verbrauchen zusätzliche Energie, um ihre Temperatur zu halten, wenn sie voneinander isoliert sind.
Trotz dieser Kosten lohnt sich der Aufwand oft. Aus evolutionsbiologischer Sicht bieten diese Verhaltensweisen bei vielen Arten einen Selektionsvorteil: Tiere, die während einer Epidemie auf soziale Distanzierung setzten, hatten eine höhere Überlebens- und damit Fortpflanzungswahrscheinlichkeit. So haben sie dieses Verhalten an nachfolgende Generationen weitergegeben.
Zum Merken. Tiere vieler Arten können ihr Sozialverhalten dem Gesundheitsrisiko entsprechend anpassen. Sie machen unter normalen Bedingungen das Beste aus ihren sozialen Beziehungen, können diese aber auf ein Minimum reduzieren, sobald ansteckende Krankheiten auftreten.
Für Biologen stellen diese Verhaltensanpassungen eine echte «Verhaltensimmunität» dar, die die biologische Immunität verstärkt.
Heidi.news