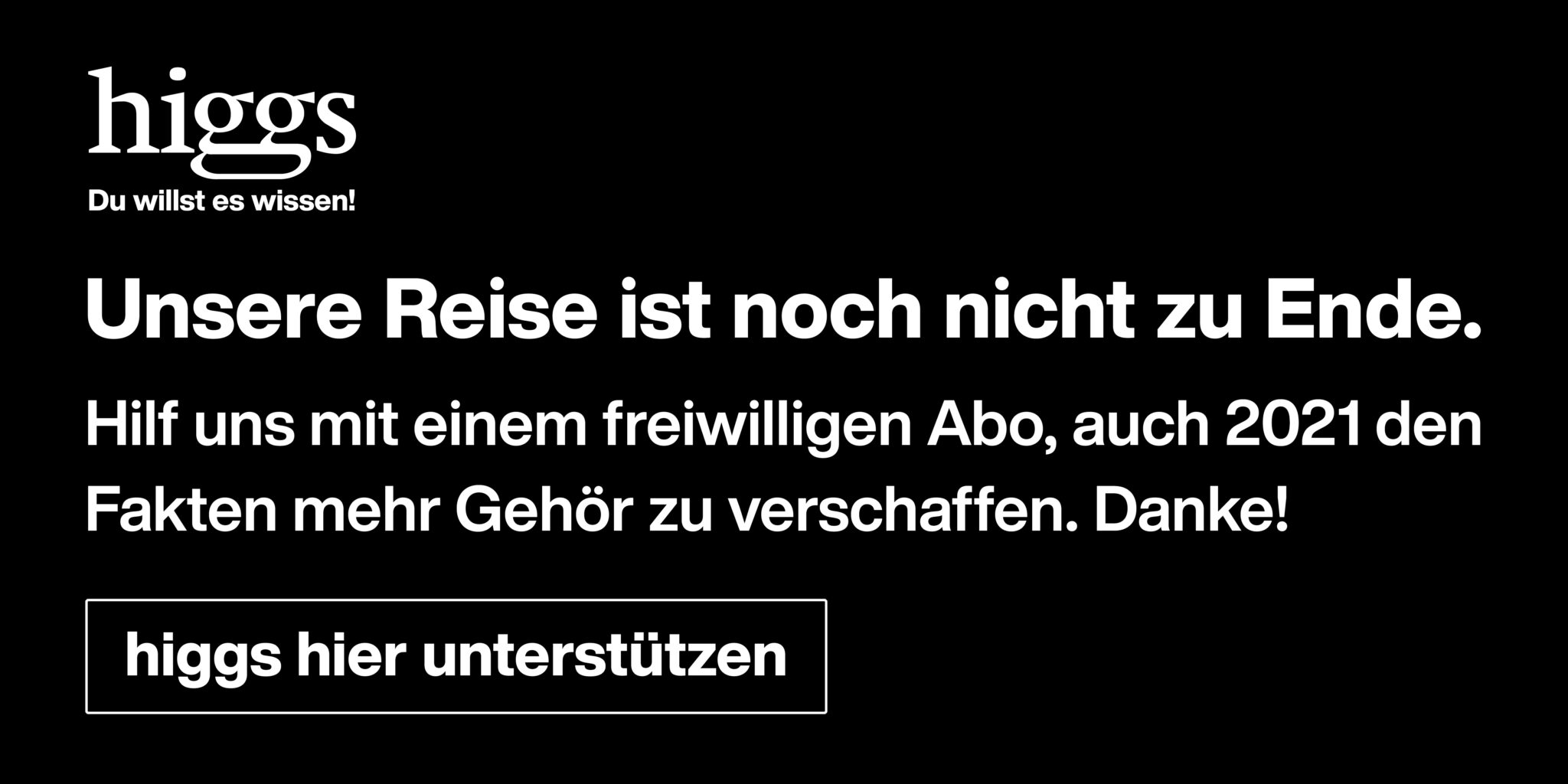Das musst du wissen
- Am 11. Oktober 2021 beginnt die 15. Biodiversitätskonferenz Cop15 im chinesischen Kunming.
- Länder mit hoher Biodiversität werben für strengere Regeln im Umgang mit genetischen biologischen Ressourcen.
- Forschende aus den Industrieländern warnen hingegen vor den negativen Konsequenzen für den freien Wissensaustausch.
Seit hunderten Jahren kennen die Khoisan, die Ureinwohner des südlichen Afrikas, die Hoodia-Pflanze. Auf ihren oft tagelangen Jagdzügen durch die Kalahari-Wüste essen die Jäger die Pflanze. Wer die Hoodia verzehrt, hat ein weniger starkes Hungergefühl. So wird es im traditionellen Wissen der Khoisan überliefert.
Als Appetitzügler erregte die Sukkulente in den neunziger Jahren die Aufmerksamkeit der Pharmakonzerne. Ein südafrikanisches Forschungszentrum patentierte den aktiven Wirkstoff und überliess das Patent einem britischen Pharmaunternehmen. Diesem kaufte kurz darauf Pfizer die Vermarktungsrechte für 21 Millionen US-Dollar ab. Kein Cent davon erreichte die Khoisan in der Kalahari, ohne deren indigenes Wissen die ganze Forschung und Entwicklung wohl nie zustande gekommen wäre.


Hoodia Gordonii in der Karoo, einer Halbwüste in den Hochebenen Südafrikas.
Weltgemeinschaft setzt sich für gerechten Vorteilsausgleich ein
Der oben beschriebene Fall ist ein klassisches Beispiel für Biopiraterie. Also die Aneignung von Wissen oder natürlichen Ressourcen, ohne Beteiligung indigener Gemeinschaften. Um dieses Problem und andere Herausforderungen des Umgangs mit der Biodiversität auf globaler Ebene anzugehen, traf sich die internationale Gemeinschaft 1992 in Rio de Janeiro. An dieser sogenannten Rio-Konferenz einigten sich die Mitgliedsstaaten auf ein Rahmenwerk, welches dem künftigen Umgang mit der Biodiversität regeln sollte: Die Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen.
In dieser Konvention sind drei gleichrangige Ziele festgehalten: Der Schutz der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nutzung ihrer Bestandteile und der gerechte Ausgleich von Vorteilen, die sich aus der Nutzung dieser genetischen Ressourcen ergeben, inklusive einem angemessenen Zugang. 196 Staaten haben die Konvention bis heute ratifiziert, die Vereinigten Staaten gehören zu den wenigen Ländern, die sich nicht beteiligen.
«Seit der Rio-Konferenz ist Biodiversität gewissermassen nationales Eigentum»Urs Eggli, Botaniker
Nach den ersten Verhandlungen in den 90er-Jahren dauerte es neun Gipfeltreffen und 22 Jahre, ehe 2014 mit dem Nagoya-Protokoll ein völkerrechtlicher Rahmen für das Abkommen in Kraft trat. Endlich gab es einen Mechanismus, in dem der Zugang zu genetischen Ressourcen und der gerechte Vorteilsausgleich umgesetzt werden konnte. Seitdem gibt es ein rechtlich bindendes «Access and Benefit-Sharing», so der internationale Begriff.
Wissenschaft gegen Gerechtigkeit?
Ein internationales Abkommen, das eine gerechte Entschädigung für biologische Vielfalt schaffen soll – wer könnte da etwas dagegen haben? Die überraschende Antwort: Am lautesten dringt die jüngste Kritik am Access and Benefit-Sharing aus der europäischen Wissenschaft.
Stein des Anstosses ist die 15. Konferenz der Teilnehmerstaaten der Biodiversitätskonvention, die am 11. Oktober 2021 beginnt. Im Rahmen des Treffens wollen die Staaten entscheiden, wie das Access and Benefit-Sharing auf digitale Sequenzinformationen angewendet werden soll. Hinter dem sperrigen Begriff versteckt sich ein riesiger Wissensschatz: Die Datenbank aller bisher entschlüsselten Genome, also die Folge von DNA-Basen, die schlussendlich das Erbgut eines Organismus ergibt. Die bisherige Gestaltung des Abkommens liess offen, ob und wie es für solche genetischen Ressourcen gelten soll. 2018 einigten sich die Staaten, ihre diesbezüglichen Differenzen zu klären – nun sollen klare Regeln geschaffen werden.
Bisher konnten Forschende weltweit und jederzeit auf unzählige DNA-Sequenzen zugreifen – von simpel aufgebauten Viren bis zu hoch komplexen Säugetieren. Die Datenbank umfasst bereits heute mehr als 1,5 Milliarden Einträge und verzeichnet über dreissig Millionen Zugriffe pro Jahr, Tendenz stark steigend. Die Inhalte waren für alle offen und konnten ohne Zugangsbarrieren geteilt werden.
Aber: Je nachdem, wie die gewaltige Datenbank der digitalen Sequenzinformationen nun dem Access und Benefit-Sharing unterstellt wird, könnte es mit dem offenen Austausch bald vorbei sein. Diese Bedenken äusserten über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Vorfeld der Biodiversitätskonferenz in einem offenen Brief. Neue Hürden könnten den Forschungsprozess ausbremsen, so die Sorge der Unterzeichnenden. Als Beispiel führen sie das Coronavirus an: Wenige Wochen nach der Entdeckung von Sars-CoV-2 gab es Diagnosekits für einen Test auf eine Infektion, binnen eines Jahres gab es die ersten Impfstoffe und ein umfangreiches Varianten-Monitoring. All das sei nur dank dem schnellen Austausch der Sequenzinformationen des Virus möglich gewesen. Würden bürokratische Hürden diesen Prozess behindern, hätte das fatale Folgen.
Theorie trifft Wirklichkeit
Zwischen globaler Ungerechtigkeit und Freiheit der Wissenschaft finden wir uns in einem Dilemma wieder. Dieses Dilemma ist nicht neu, wie ein Blick auf die derzeitige Praxis zeigt: Während sich die Wissenschaft schon jetzt über die Hürden beklagt, hat die Wirtschaft sich bisher wenig am Access and Benefit-Sharing beteiligt.
Das zeigt sich am Beispiel der Schweiz, die zu den Ländern gehört, die von Anfang an am Access and Benefit-Sharing mitgewirkt haben: Seit 2014 unterliegen entsprechende Transaktionen von genetischen Ressourcen diesen Bestimmungen. Hierbei gilt eine Sorgfaltspflicht, die jedoch in der Praxis meist nicht überprüft wird. Erst, wenn die Verwendung genetischer Ressourcen in der Lancierung eines Produkts – und damit in einem finanziellen Ertrag – endet, besteht eine Meldepflicht. Wie sich der Vorteilsausgleich gestaltet, muss nicht deklariert werden.
Im Register der Schweizer Produkte, die genetische Ressourcen aus dem Ausland verwenden, gibt es bislang nur einen einzigen Eintrag: ein Produkt, welches die Pflanze Myrothamnus flabellifolia aus Südafrika verwendet – die auch als Auferstehungspflanze bekannt ist. Auch der Blick auf die internationale Ebene deutet auf den bislang geringen Einfluss des Access and Benefit-Sharings hin: Nur gerade 23 der 131 Mitgliedsstaaten des Nagoya-Protokolls haben als Geberländer überhaupt genetische Ressourcen ihres Landes zur Verfügung gestellt. Sieben Jahre nach der Ratifizierung hat sich das Access and Benefit-Sharing also noch lange nicht durchgesetzt.
Hürden für Forschende
Gleichzeitig lässt sich der Einfluss des Abkommens auf die Wissenschaft bereits jetzt nicht von der Hand weisen, wie auch der Botaniker Urs Eggli weiss. Er ist seit über dreissig Jahren Kurator und betreibt daneben Grundlagenforschung an Sukkulenten – in der Zürcher Sukkulenten-Sammlung, aber auch in den Herkunftsländern der Pflanzen, ohne dabei wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Für ihn gehört Austausch von genetischen Ressourcen zum Forschungsalltag: Dabei werde Pflanzenmaterial oftmals vor Ort von einer Institution an die andere übergeben, erzählt Eggli. Hier stellt das Access and Benefit-Sharing bereits jetzt oft eine bürokratische Hürde dar: «Die Formulare auszufüllen ist aufwändig und zudem hat jedes Land seine eigene Handhabe.»


Urs Eggli, Botaniker an der Zürcher Sukkulenten-Sammlung, mit der Auszeichnung Cactus d’Or.
Und manche Länder nehmen es besonders ernst: «Viele Länder mit grosser Biodiversität legen das Access and Benefit-Sharing sehr restriktiv aus», so Eggli. Darunter finden sich viele Länder der Subtropen und Tropen, also meist weniger wohlhabende Länder des globalen Südens. Gerade in diesen artenreichen Ländern würde das Access and Benefit-Sharing oft auf finanzielle Aspekte reduziert. Eggli möchte dem Grundgedanken des Access and Benefit-Sharing keinesfalls widersprechen. Ein Benefit müsste aber keinesfalls stets ein finanzieller Vorteil sein, findet Eggli. «Ein Stipendium oder eine Doktoratsstelle für eine Person aus dem Herkunftsland – das wäre auch ein Benefit-Sharing.» Eine solche Handhabung wird vom Nagoya-Protokoll auch nicht ausgeschlossen. «Aber in vielen Ländern läuft es darauf hinaus, dass man ein Preisetikett daran hängt.» Traditionellerweise habe man biologisches Material als das gemeinsame Erbe unseres Planeten erachtet, das man schützen und erhalten solle. «Seit der Rio-Konferenz ist Biodiversität gewissermassen nationales Eigentum», sagt Eggli. Damit können Staaten letztlich machen, was sie wollen, und beispielsweise einen «Eintrittspreis» von Forschenden verlangen – entgegen zur eigentlichen Intention des Abkommens, die Wirtschaft zur Kasse zu bitten.
Vorteilsausgleich ja – aber auch gerecht?
Selbst wenn man den Vorteilsausgleich wie vorgesehen umsetzen könnte bleibt die Frage: Was ist gerecht? Anlässlich der aktuellen Diskussion um die Sequenzinformationen beschäftigt das auch die UN-Funktionäre. Die Meinungen divergieren deutlich. Während sich der globale Süden vor einer Ausbeutung seiner biologischen Vielfalt fürchtet und strengere Regeln möchte, sehen die Forschenden des globalen Nordens ihre nicht-kommerzielle Wissenschaft gefährdet. Schlussendlich bedarf vor allem die kommerzielle Nutzung einer Regulierung – doch die Grenzziehung ist komplex: Nicht-kommerzielle Grundlagenforschung hat stets das Potenzial, eines Tages wirtschaftlich relevant zu werden. Setzt das Access und Benefit-Sharing also erst bei der kommerziellen Nutzung an, steigt die Gefahr der Ausbeutung wieder.
Damit wird der an sich simple Gerechtigkeitsgedanke in der politischen Umsetzung – auf einer globalen Ebene, in einer fragmentierten Welt, in der die Politik dem technologischen Fortschritt stets einen Schritt hinterher hinkt – zu einem beinahe unlösbaren Problem. Antworten hat die Weltgemeinschaft bisher noch keine. In welche Richtung es gehen wird, ist noch nicht klar.
Doch zurück zu den Khoisan in der Kalahari: Zahlreiche NGOs, darunter auch PublicEye aus der Schweiz, lenkten die internationale Aufmerksamkeit auf den Fall. Das bewegte die Pharmaindustrie zum Einlenken: Verträge sicherten den Khoisan zumindest einen kleinen Anteil an den Lizenzgebühren zu. Doch Pfizer gab die Entwicklung eines Hoodia-Medikamentes auf, und so erhielten die Khoisan am Ende keinen Rappen.
Heute verkaufen zwielichtige Naturheilmittel-Unternehmen Hoodia-Produkte und werben dabei mit der traditionellen Nutzung. In den Vertragslisten des Access and Benefit-Sharings taucht Hoodia aber noch immer nicht auf. Und selbst wenn es so wäre, bleiben offene Fragen: Die Khoisan besitzen keinen eigenen Staat, ihr Siedlungsgebiet erstreckt sich über mehrere Länder im südlichen Afrika. Damit gibt es auch keine Regierung, die dafür sorgen würde, dass die Khoisan zu ihrem Recht kommen. Bis der Vorteilsausgleich gerecht wird – mit oder ohne Erweiterung auf Sequenzinformationen – hat das Access and Benefit-Sharing damit noch einen weiten Weg vor sich.