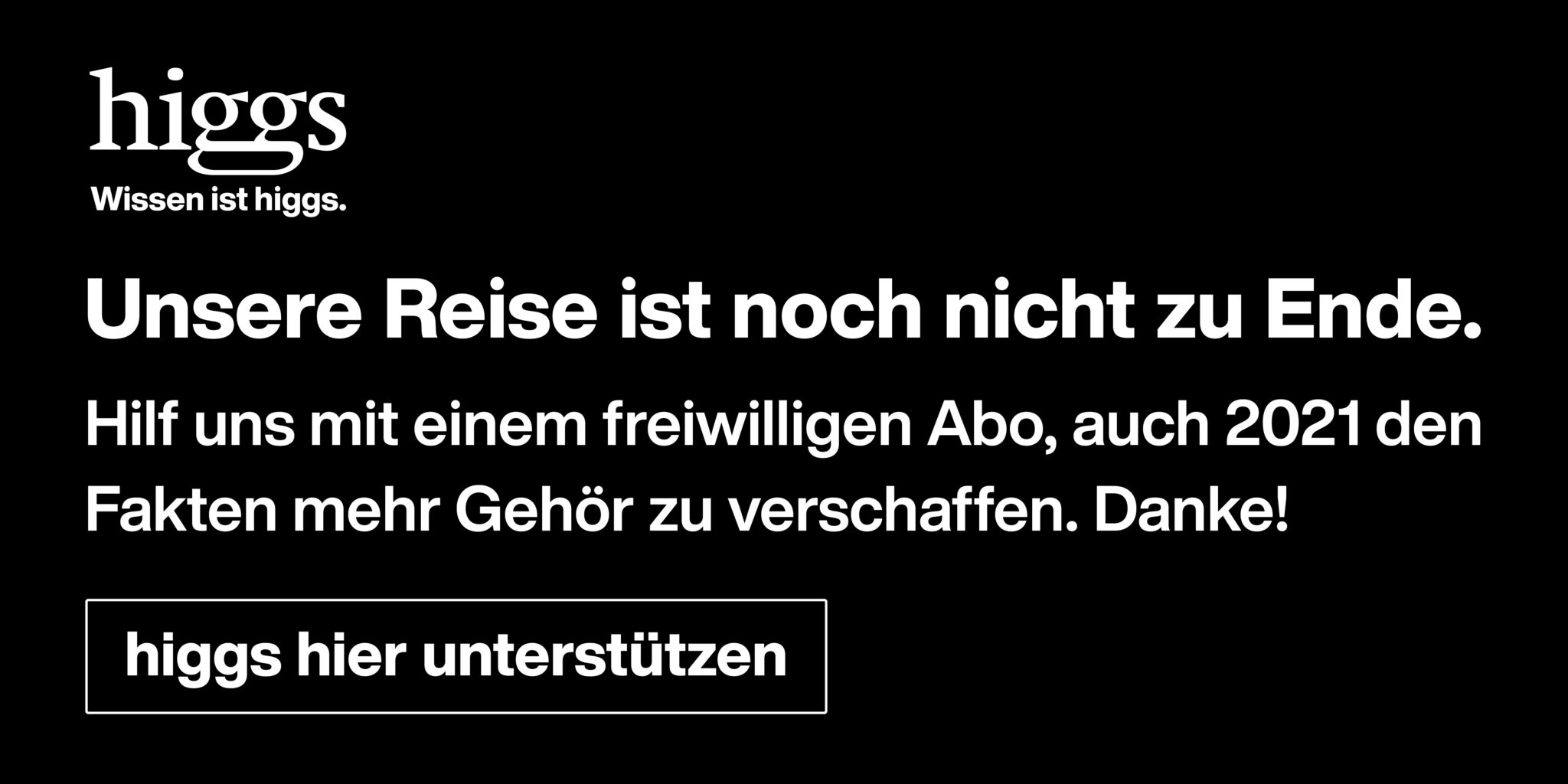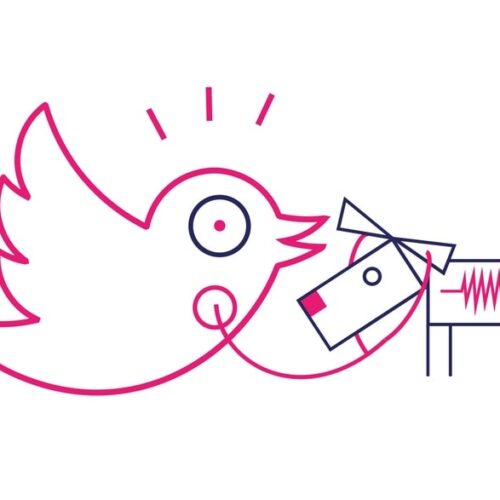«Seit Beginn der Pandemie ist es zu einem regelrechten Tsunami von wissenschaftlichen Publikationen über Sars-CoV-2 gekommen», sagt Subhra Priyadarshini, Chefredaktorin von Nature India, Sie hat kürzlich an einer Online-Diskussion über Wissenschaftskommunikation teilgenommen, organisiert von den Akademien der Wissenschaften Schweiz.
Weltweit hatten 2020 ganze vier Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen mit dem Coronavirus zu tun, wie Nature berichtet. Besonders zu Beginn der Pandemie musste es schnell gehen. Deshalb wurden so viele Studien wie nie zuvor bereits als so genannte Preprints veröffentlicht, noch vor der Überprüfung durch unabhängige Gutachterinnen und Gutachter aus dem gleichen Fachgebiet, der so genannten Peer Review.
Laut Luca Tratschin, Wissenschaftssoziologe am Kompetenzzentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung der Universität Zürich, steckt die Wissenschaft in dieser Frage in einem Dilemma: Sind ihr Qualität oder rasche Ergebnisse wichtiger? Durch die Publikation von Preprints werde vorerst dafür gesorgt, «dass wissenschaftliche Einsichten möglichst früh und in einem handlungsrelevanten Zeithorizont rezipiert werden können.»
Gleichzeitig bestehe «die Gefahr, diese unreifen Resultate später öffentlich korrigieren zu müssen». So beispielsweise geschehen mit zwei grossen Covid-19-Studien mit dem Malariamittel Hydroxychloroquin, die in den namhaften Fachmagazinen The Lancet und New England Journal of Medicine publiziert worden waren und zurückgezogen werden mussten.
Auch eine Schweizer Studie musste Untersuchungen, die auf Hydroxychloroquin basierten, nachträglich fallen lassen. Und der Pharmariese Novartis bezeichnete das Malariamittel eine gewisse Zeit lang als Hoffnungsträger. Es sind Beispiele, die zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung führen und Falschinformationen Vorschub leisten können.
Die Maulkorb-Debatte
In der Schweiz wurden viele Preprint-Studien von der nationalen Covid-19-Science-Taskforce geprüft, um daraus ihre Empfehlungen für die Regierung abzuleiten. Mitglieder der Taskforce – und die Studien, die sie evaluierten – gerieten dabei zusehends ins Kreuzfeuer von Politik und Öffentlichkeit.
Nachdem einige Wissenschaftler der Taskforce ihren Unmut darüber ausgedrückt hatten, dass die Regierung ihren Ratschlägen nicht folgt, empfahlen einige Parteivertreterinnen und -vertreter, den Forschenden zu verbieten, sich öffentlich zu den Pandemiemassnahmen zu äussern.
Eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, unzufrieden mit dem Lockdown und der Einschränkung der Versammlungsfreiheit, startete ein Referendum gegen das Covid-19-Gesetz, das den Pandemiemassnahmen der Regierung einen rechtlichen Rahmen gibt.
Das Schweizer Stimmvolk wird am 13. Juni an der Urne darüber abstimmen. Die so genannte «Maulkorb-Klausel», die es Mitgliedern der Taskforce verbieten sollte, sich öffentlich zu äussern, ist nicht mehr Teil des Gesetzes. Sie war nach einer kontroversen und hitzigen Debatte vom Parlament gestrichen worden. Trotzdem wird die Frage aufgeworfen: Wo bleibt da das Vertrauen in die Wissenschaft – jetzt und in Zukunft?
Eine Frage des Weltbilds
«Das Problem ist, dass die Wissenschaft manchmal unangenehme Realitäten präsentiert», gibt Reto Knutti zu bedenken. «Und dann ist die Versuchung gross, dass man sagt, die Experten hätten keine Ahnung, oder sie wollten sich profilieren. Obwohl es eigentlich gar nicht um das Vertrauen in die Wissenschaft geht, sondern nur darum, dass das Ganze nicht ins eigene Weltbild passt.» Knutti ist Professor für Klimaphysik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH).
Grundsätzlich glaubt Knutti nicht, dass die Wissenschaft unter den Covid-19-Kontroversen allzu sehr gelitten hat; er verweist auf die Ergebnisse des Wissenschaftsbarometers, das mitten in der Pandemie entstanden ist. Laut dieser Umfrage sind das Interesse und das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in die Wissenschaft in dieser schwierigen Zeit sogar gestiegen.
Knutti ist jedoch der Meinung, dass die Öffentlichkeit kompetent sein sollte, zwischen einer einzelnen Studie oder Vorstudie ohne Peer Review und einem wissenschaftlichen Konsens zu unterscheiden. Als Beispiel nennt er die wissenschaftliche Schlussfolgerung des UNO-Klimagremiums IPCC, die besagt, dass sich der Klimawandel schnell vollziehe.
In diesem Fall hätten «tausend Leute über fünf Jahre hunderttausend Studien begutachtet und dann daraus einen robusten Konsens erarbeitet». Knutti war massgeblich an zwei IPCC-Berichten beteiligt.
Demgegenüber stehe die Forschung mit der Coronavirus-Pandemie vor der grossen Herausforderung und den Erwartungen von Politik und Öffentlichkeit, innerhalb kürzester Zeit mit brauchbaren Resultaten aufzuwarten. Bei anderen Themen dauere so ein Prozess Jahrzehnte. «Jetzt machten wir das innerhalb eines Jahres durch. Mit allen Querschlägern und Nebenwirkungen, die das mit sich bringt.»
Die Rolle der Medien
Ein Grossteil der Verantwortung für die Kommunikation wissenschaftlicher Resultate liegt bei den Medien. Die Umfrage #CovidSciCom verschiedener Organisationen und Institute in der Schweiz, den USA und Indien ergab kürzlich, dass Forschende und Universitäten glaubwürdiger erscheinen als Journalistinnen und Journalisten. Allerdings habe die Flut an Publikationen die Glaubwürdigkeit der Forschung beeinträchtigt. Weit abgeschlagen landeten Influencer und Kolumnistinnen – für viele junge Menschen eine wichtige Informationsquelle.
Als grösste Herausforderung erachten alle befragten Personen die Qualitätskontrolle – in Fachjournalen wie auch in den Medien. Priyadarshini von Nature India sagt, bei ihnen würden nur die besten Preprint-Studien herausgepickt und immer als solche ausgewiesen. «Es liegt dann an uns Medienschaffenden, eine Art Peer Review zu machen und Expertinnen und Experten zu kontaktieren.»
Aber wird das überall so gemacht? Und unterscheiden die Medien ausreichend zwischen den Arten von Studien, die durchgeführt werden, und erklären deren Mängel? „Viele Redaktionen, viele Zeitungen oder Radiosender haben in den letzten Jahren den Wissenschaftsjournalismus abgebaut“, bedauert Tratschin.
Knutti sieht das Problem nicht unbedingt bei den Medien, sondern in der Tatsache, «dass wir nicht bereit sind, für qualitativ hochwertige Informationen zu bezahlen: Der Druck auf die Medien ist enorm, Wissenschaftsjournalismus kostet, die Leute lesen kaum mehr und konsumieren ihre Informationen in den sozialen Medien».
Zweifel thematisieren
Erschwerend kommt dazu, dass Wissenschaft nicht nur aus Resultaten besteht, sondern zuallererst mal aus Debatten, dem Ausprobieren und Nachvollziehen von Theorien und aus deren möglichem Scheitern. In der Wissenschafts-Community herrscht ein breiter Konsens, dass Letzteres oft zu wenig thematisiert werde.
_____________
Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️
_____________
«Wissenschaft produziert immer neues Wissen. Aber dieses neue Wissen wird begleitet von noch mehr Fragen, mehr Ungewissheit, mehr Nichtwissen», sagt Tratschin. Diese Ambivalenz sei das Dilemma, aber auch das Faszinierende der wissenschaftlichen Tätigkeit. «Jedes wissenschaftliche Resultat ist mit Ungewissheit verbunden und muss methodisch und konzeptuell eingeschränkt werden. Wissenschaft spiegelt nicht einfach eine klar und eindeutige gegebene Wirklichkeit wider.»
Die komplexen wissenschaftlichen Erkenntnisse und Aussagen werden in den Medien oft verkürzt, verzerrt und zugespitzt dargestellt. «Covid-19 zeigte, dass wir mehr machen müssen, dass wir aufzeigen müssen, was wir wissen und was nicht, aber keine Rezepte geben sollten. Diese Unterscheidung müssen wir stärken», so Marcel Tanner, Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz.
Knutti schlägt vor, dass Forschende ihre Erkenntnisse in eine Geschichte verpacken sollten, um sie verständlich und nachvollziehbar kommunizieren zu können. Er zitiert den Ökonomen und Nobelpreisträger Daniel Kahneman. «Niemand hat jemals einen Entscheid aufgrund einer Zahl getroffen. Sie brauchen eine Geschichte.»
Vielleicht sei die Maulkorb-Debatte um die nationale Covid-Taskforce ja gar nicht so schlecht gewesen, meint Knutti. «Diese und der Widerstand aus Öffentlichkeit und Medien haben gezeigt, dass es kein Weg ist, die unangenehmen Fakten totzuschweigen oder zu zensurieren.» Eigenverantwortung könne nur dann funktionieren, «wenn man sich selber ein informiertes Bild machen kann und all diese Einschätzungen auch auf dem Tisch liegen».
Schliesslich gibt Knutti in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Wissenschaftskommunikation und die Beratung der Politik am Ende zwei verschiedene Paar Schuhe sind: «Ersteres ist die Frage des Medienkonsums, das andere, wie man einen Dialog mit der Politik etablieren kann.» Und falls die Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und Medien funktioniere, bedeute das noch lange nicht, «dass wir mit der Politik einen Prozess finden, wie man sich austauscht».