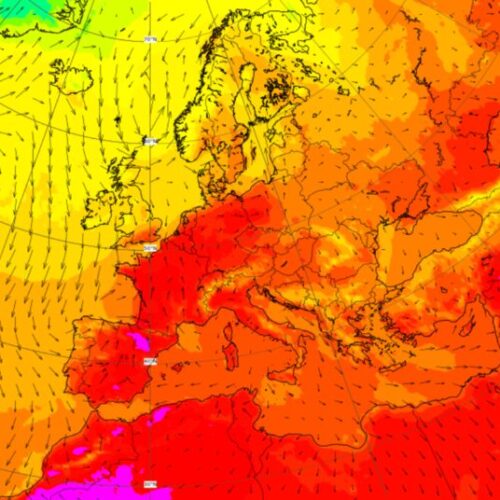Das musst du wissen
- Die ETH Lausanne ist am Forschungsprojekt Iter beteiligt. Getestet wird, wie man in Zukunft Strom erzeugen kann.
- Die Teilnahme der Schweizer Forschenden wurde mit dem Nein zum Rahmenabkommen der EU in Frage gestellt.
- Nun zeichnet sich eine mögliche Lösung ab. Der Ball liegt bei der EU – und bei den Mitgliedsländern des Projekts.
Westschweizer Forschende sehen sich mit einer Knacknuss konfrontiert: Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) ist Partner des Projekts Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) – eines neuartigen wissenschaftlichen Experiments, das Strom aus Fusionsenergie erzeugen will. Es soll die wissenschaftliche und technologische Machbarkeit der Kernfusion beweisen. Im Zentrum steht ein thermophysikalisches Phänomen: Zwei Atomkerne werden miteinander verschmolzen – anstatt wie bei der Kernspaltung getrennt zu werden – und setzen dabei eine enorme Menge an Energie frei. Der Iter-Versuchsreaktor, der sich derzeit im Bau befindet, soll bis 2027 erste Ergebnisse liefern.
Warum es harzt. Das ehrgeizige wissenschaftliche Projekt entstand aus einer engen internationalen Zusammenarbeit. Dies zwischen der Europäischen Union, einschliesslich der Schweiz, im Rahmen von Euratom sowie China, Indien, Japan, Korea, Russland und den USA. Es wurde jedoch von den politischen Turbulenzen zwischen der Eidgenossenschaft und Brüssel eingeholt. Im Frühjahr 2021 sorgte das «Nein» zum Rahmenabkommen mit Europa für grossen Wirbel in akademischen Kreisen der Schweiz. Ebenso wie ihre Beteiligung am Forschungsprogramm Horizon Europe wurde auch die Beteiligung der Schweiz an Euratom – und indirekt auch an Iter in Frage gestellt.
Das Prinzip. Die ersten Konzepte für «Tokamak», die russische Abkürzung für Ringkernkammer mit Magnetspulen, wurden Mitte der 1950er-Jahre in der Sowjetunion entwickelt. Die Herausforderung bestand darin, eine Kernfusionsreaktion zu kontrollieren. Und sie mithilfe eines Magnetfelds, das von starken Magneten erzeugt wird, einzuschliessen.
Um die Reaktion einzuleiten, werden einige Gramm Deuterium und Tritium verwendet – Isotope des Wasserstoffs. Ab sehr hohen Temperaturen gehen sie von einem gasförmigen in einen elektrisch geladenen Plasmazustand über. Dieser kann durch Magnete leichter kontrolliert und geformt werden.
Im Versuchsreaktor sollen die Fusionsreaktionen bei einer Temperatur von 150 Millionen Grad Celsius ablaufen. Dabei setzen sie hochenergetische Neutronen frei, die nicht vom Magnetfeld eingeschlossen werden. Ihre kinetische Energie – in anderen Worten: ihre Bewegung – wird Wärme freisetzen, die 500 Megawatt thermischer Energie entspricht. Bei einer möglichen industriellen Anwendung kann diese über einen Druckwasserkreislauf abgeführt werden, der eine elektrische Turbine antreibt.
Die Beteiligung der EPFL. Das Swiss Plasma Center an der EPFL ist ein langjähriger Forschungspartner von Iter. Der Leiter des Labors, Ambrogio Fasoli, Forscher auf dem Gebiet der Fusions- und Plasmaphysik, erklärt:
«Euratom soll die industriellen Anwendungen der Kernspaltung, aber auch der Kernfusion entwickeln. Dass die Schweiz nun davon ausgeschlossen ist, ist ein Problem – denn sie ist auf europäischer Ebene ein wichtiger Forschungspartner. Wir hoffen, in Zukunft wieder daran beteiligt zu sein.»
Denn das Swiss Plasma Center der EPFL bleibt ein wichtiger Partner für das Forschungsexperiment. Ambrogio Fasoli listet einige Beispiele auf, bei denen dieser Beitrag unverzichtbar ist:
«Dazu gehören Mikrowellentechnologien, die es ermöglichen, mit Instabilitäten im Plasma umzugehen. Oder solche, die eine Echtzeitkontrolle des Plasmas ermöglichen. Wir sind eines der wenigen rein akademischen Forschungslabors: Wir bilden viele junge Köpfe aus, die später mit dem Versuchsreaktor arbeiten können.»
Die beiden Probleme. Auf europäischer Ebene sind zwei Strukturen involviert, wie Ambrogio Fasoli erläutert.
- Zunächst einmal das Eurofusion-Konsortium. Es besteht aus etwa dreissig Ländern und 150 Forschungseinrichtungen. Es ist das Instrument von Euratom, um die Forschung zur Kernfusion durchzuführen. Sein Vorsitz wechselt, und Ambrogio Fasoli ist der derzeitige Vorsitzende.
- Dann gibt es noch das eigentliche Iter-Projekt. «Euratom finanziert Iter zu fast fünfzig Prozent. Und die Schweiz ist jetzt aus Euratom ausgeschlossen», erklärt er.
Die Lösung für Eurofusion ist gefunden. Am 13. Dezember wurde sie in einer Medienmitteilung bekannt gegeben: Die Schweiz und das Vereinigte Königreich werden assoziierte Partner von Eurofusion, und zwar via Deutschland. Der Unterschied ist, so Ambrogio Fasoli, dass die Schweiz und das Vereinigte Königreich dadurch nicht die Möglichkeit haben, an Abstimmungen teilzunehmen. «Sie werden nur Beobachter sein», erklärt der Direktor des Swiss Plasma Center, «aber sie können trotzdem mit ihren eigenen Finanzmitteln an Forschungs- und Entwicklungsprojekten teilnehmen».
Das zweite Hindernis. Das zweite, nicht zu unterschätzende Problem, das es zu lösen gilt, bleibt die Schweizer Beteiligung am eigentlichen Forschungsprojekt:
Vor drei Wochen hat der Generaldirektor von Iter, Bernard Bigot, die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Schweiz erkannt und ist eigens nach Lausanne gereist. Dort hat er sich mit Martina Hirayama, der Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation sowie dem Präsidenten der EPFL, Martin Vetterli, über die Situation ausgetauscht.
Ambrogio Fasoli erläutert die Lösung, die aktuell in Betracht gezogen wird: «Die EPFL könnte Iter direkt als Institution beitreten. Nun wird es ein schriftliches Verfahren geben, bei dem die verschiedenen Iter-Mitgliedsländer, darunter auch die Europäische Union, konsultiert werden und einstimmig entscheiden müssen. Es ist nicht einzusehen, warum die Partner nicht zustimmen sollten. Jetzt warten wir ab, was wirklich passiert.»
Er fügt abschliessend hinzu:
«Iter ist eine Weltpremiere, die Europa nicht allein bewältigen kann. Und es wäre sehr traurig, wenn die Schweiz von dem derzeit ehrgeizigsten wissenschaftlichen Experiment ausgeschlossen würde, nachdem sie jahrelang dazu beigetragen hat. Aber ich bin optimistisch, was unsere Chancen angeht. Wenn keine Win-Win-Lösung gefunden wird, besteht die Gefahr, dass es eine Lose-Lose-Lösung wird.»
Heidi.news