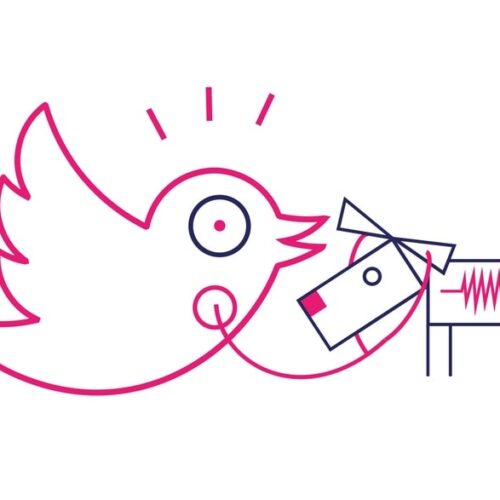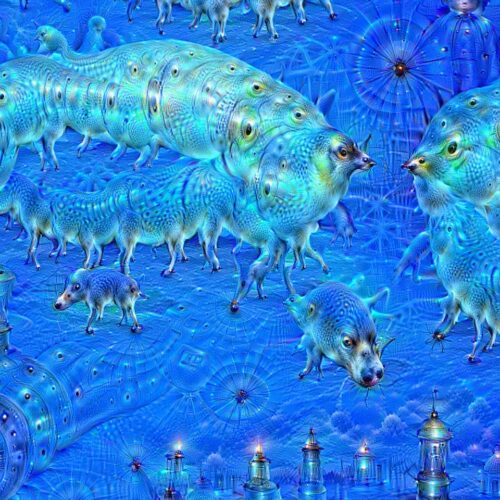Das musst du wissen
- Soziale Medien sollen den Zusammenhalt fördern, geben uns aber das Gefühl, einsam und sozial isoliert zu sein.
- Und, sie lassen uns unablässig glauben, etwas zu verpassen.
- Laut einer Psychologin lässt sich dies mitunter auf die Angst vor Kontrollverlust und Neid zurückführen.
Freitagabend – nach der strengen Arbeitswoche freust du dich auf einen Abend auf der Couch. Bevor du Rezeptideen oder Netflixtipps googelst, schaust du noch kurz auf Instagram vorbei. Doch jeder Post lässt deine Laune schlechter werden. Alte Schulkollegen lachen in Videos aus vollen Kneipen – haben die überhaupt gefragt, ob du mitkommen willst? Eine Freundin ist derweil offensichtlich ins Ski-Weekend gestartet und teilt Bilder von der Traumkulisse – du kannst nicht mal Skifahren, aber Fotos im Schnee sehen so gut aus. Die ganzen Memes auf der Timeline verstehst du auch nicht – die Serie, auf die sie anspielen, interessiert dich eigentlich nicht, aber du willst sie jetzt trotzdem sehen, um mitlachen zu können. Gleichzeitig prasseln noch Mails von einem besonders fleissigen Arbeitskollegen rein – und jetzt fühlst du dich auch noch schlecht, weil du bereits Feierabend gemacht hast. Eine halbe Stunde Doomscrolling hat gereicht, um dir den Abend zu vermiesen. Herzlichen Glückwunsch, nun hast du Fomo!
Fomo bedeutet «Fear of missing out» und beschreibt die Angst davor, etwas zu verpassen, nicht zu einer Gruppe zu gehören und nicht mitreden zu können. Auch wenn obige Beispiele es vermuten liessen, ist das kein neues Phänomen: «Diese Angst gibt es nicht erst, seit es Smartphones gibt», sagt die Psychologin Julia Brailovskaia, die in Bochum an der Ruhr-Universität und am Center Of Advanced Internet Studies die Zusammenhänge zwischen Onlinemedien und psychischer Gesundheit erforscht. «Ich hatte als Jugendliche auch Angst, etwas zu verpassen, wenn ich nicht auf eine Party gehen konnte. Diese Sorge wird mir heute in den sozialen Medien aber auf dem Silberteller präsentiert.» Das Gefühl, nicht dazuzugehören, tritt dadurch also deutlich häufiger auf als früher. Deshalb wurde Fomo auch erst in den vergangenen Jahren zu einem bekannten Massenphänomen, wie die weltweiten Google-Suchanfragen nach dem Begriff zeigen:
Warum Fomo für Facebook und Co ein lukratives Geschäft ist
Den Stressfaktor scheinen die sozialen Medien aber durchaus erhöht zu haben: Man könnte den Post einer Freundin verpassen, weil er nur eine begrenzte Zeit angezeigt wird, oder nicht auf alle Nachrichten antworten, weil man gerade beschäftigt ist. So hat eine Studie beispielsweise herausgefunden, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir auf einem Foto bei Instagram nicht markiert werden. Damit verstärken die sozialen Medien die Angst, etwas zu verpassen, also – und zwar bewusst.
Denn die sozialen Netzwerke sind so gestaltet, dass wir möglichst viel Zeit darin verbringen sollen – schliesslich sehen wir uns dabei auch mehr von den Werbebeiträgen auf den Internetseiten an, womit Facebook und Co. mitunter ihr Geld verdienen. Die Werbung selbst bedient sich ebenfalls der Fomo: «Sieben Personen sehen sich gerade das selbe Hotel an», «nur noch heute zwanzig Prozent Rabatt», «limitierte Auflage», «nur für Premium-Mitglieder» – überall wird mit unserer Sorge gespielt, wir könnten etwas verpassen. Diese Werbung brennt sich einer Studie zufolge damit auch besser in unser Gedächtnis ein.
Was Fomo mit Neid und Kontrollsucht zu tun hat
Doch warum fallen wir auf diese Werbung rein und wieso ziehen uns schöne Fotos so runter? Zu Fomo wird rege geforscht. So ist mittlerweile beispielsweise bekannt, dass damit depressive Symptome einhergehen können. «Gerade die passive Nutzung von Sozialen Medien – also wenn wir uns auf Instagram nur Fotos anschauen, ohne mit anderen zu interagieren – kann uns neidisch machen, denn wir vergleichen uns automatisch mit Freundinnen und Bekannten. Wenn wir eh schon schlecht drauf sind, sollten wir von Sozialen Medien lieber die Finger lassen», sagt Julia Brailovskaia. Neid ist also ein Faktor, der mit Fomo in Verbindung gebracht wird. Für die Psychologin steckt aber mehr dahinter: «Wir Menschen wollen die Kontrolle über unser Leben haben, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis. Wenn wir nicht mitreden können, nicht Teil einer Gruppe sind – dann haben wir keine Kontrolle mehr darüber, mit wem wir interagieren und an welchen Gesprächen wir uns beteiligen können. Vor diesem Kontrollverlust fürchten wir uns.»
Und wie kriegen wir diese Kontrolle wieder zurück? Ein internationales Forschungsteam hat sich dieser Frage gewidmet und so verschiedene Massnahmen entwickelt, die bei der Reduktion von Fomo helfen sollen. So können Push-Mitteilungen stummgeschaltet oder zumindest verschiedene Benachrichtigungstöne für unterschiedlich wichtige Nachrichten eingestellt werden. Auch Filter können helfen, die Timelines in den sozialen Medien so zu gestalten, dass die Beiträge individualisiert angezeigt werden. Die naheliegendste Lösung ist wohl aber auch die effektivste: Das Handy weglegen. «Wenn die Smartphone- und Social-Media-Nutzung toxisch oder suchtartig wird, sollte man die Nutzungszeit bewusst und kontrolliert reduzieren», rät Julia Brailovskaia. Wer die sozialen Medien weniger bis gar nicht nutzt, für den werden Facebook und Co. auch weniger wichtig – und so wird man weniger mit dem Gefühl, etwas zu verpassen, konfrontiert.
Science-Check ✓
Studie: Combating Fear of Missing Out (FoMO) on Social Media: The FoMO-R-MethodKommentarDies ist ein Kommentar der Autorin / des AutorsAus den bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen über Fomo wurden für diese Studie Strategien abgeleitet, wie Betroffene besser mit der Angst umgehen können – diese Massnahmen wurden dann von einer Testgruppe evaluiert und grösstenteils für sinnvoll empfunden. Die Testgruppe bestand gleichermassen aus Frauen und Männern mit einem Durchschnittsalter von unter Dreissig – junge Generationen und Frauen sind derweil häufiger von Fomo betroffen. Da nur sehr wenige Personen an der Studie teilnahmen, lassen sich die Resultate nicht verallgemeinern. Weiter ist zu bedenken, dass die Teilnahme belohnt wurde, was die Selbstauskünfte der Testpersonen verfälscht haben könnte.Mehr Infos zu dieser Studie...Kann «Digital Detox» gegen Fomo helfen?
Ob ein sogenannter «Digital Detox» – also der komplette Verzicht auf soziale Medien – wirklich zu einer höheren Zufriedenheit führen kann, ist in der Forschung aber umstritten. So zeigt eine Meta-Analyse zu diesem Thema, dass einzelne Studien zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen: Manchmal half die Online-Abstinenz, manchmal nicht – manchmal ging es den Teilnehmenden sogar schlechter. Jedoch waren die Untersuchungsgruppen oft sehr klein und die Experimente gingen in der Regel nur eine Woche.
Julia Brailovskaia zumindest findet, dass eine schrittweise, moderate Reduktion der Nutzung eine wirkungsvolle Massnahme sein kann: «Man sollte es einfach ausprobieren. Es hilft, zunächst nur schon die Nutzungszeit zu reduzieren und vielleicht eine halbe Stunde pro Tag weniger am Handy zu sein.» Die Begrenzung der Nutzungszeit kann beispielsweise mit gewissen Apps automatisch reguliert werden. Das kann sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken, wie etwa eine von Julia Braivloskaia mitverfasste Studie zeigte: Die Verringerung der Facebook-Nutzung reduzierte depressive Symptome. Eine weitere Studie begrenzte die Nutzungszeit der Teilnehmenden auf täglich nur zehn Minuten pro Social-Media-Plattform. Auch hier fühlten sich die Teilnehmenden der Studie zufolge nach drei Wochen weniger depressiv und einsam.
Mehr Aktivitäten im realen Leben steigern die Zufriedenheit
Doch: Bei so einer Insta-Diät könnte es wie bei einer richtigen Diät zu Rückfällen und einem Jojo-Effekt kommen, sagt Julia Brailovskaia: «Man sollte sich dabei immer die Frage stellen: Verpasse ich gerade wirklich etwas? Was würde schlimmstenfalls passieren, wenn ich nun einige Stunden nicht auf Instagram vorbeischaue?» Deshalb sei es wichtig, sich mit Aktivitäten im realen Leben abzulenken: spazierengehen, einen Freund anrufen, ein Buch lesen.
«Positive Emotionen im realen Leben machen uns glücklicher als in der Online-Welt – das zeigt uns dann, dass wir zum Beispiel Instagram gar nicht brauchen, um glücklich zu sein», sagt Julia Brailovskaia. Vielleicht wäre es also mal ein Anfang, nicht nur Rezeptvideos zu liken, sondern die Zutaten dafür einzukaufen und das Rezept tatsächlich nachzukochen. Wenn das Essen dann gut schmeckt, hast du schon gar nicht mehr das Gefühl, etwas zu verpassen. Ob du die Fotos von dieser Mahlzeit danach aber auf Instagram hochlädst, überlegst du dir – nach der Lektüre dieses Artikels – besser zweimal.