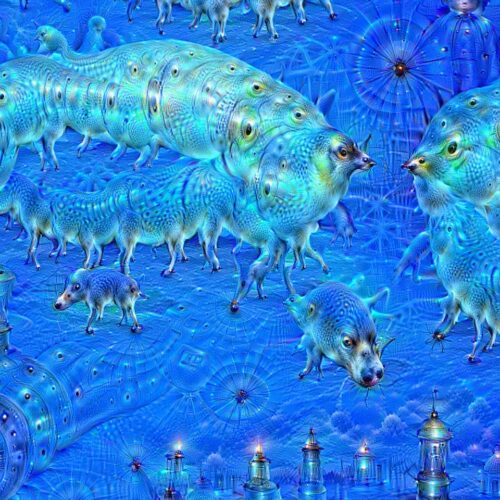Wenn ihr die Dinge wieder einmal über den Kopf wachsen, steigt Tamara T.* mit Johannes auf einen Baum. Mutter und Sohn lassen die Füsse und die Seele baumeln, bis beide ihr Gleichgewicht wiederfinden. Beide leiden an ADHS.
Der neunjährige Johannes ist das jüngste von Tamaras fünf Kindern. Drei von ihnen haben die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. ADHS ist zu einem grossen Teil vererbt. «In fast jeder Familie mit einem betroffenen Kind erkenne ich bei einem Elternteil Symptome», sagt Michael von Rhein, Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kantonsspital Winterthur.
Auch bei Tamara T. war es der Kinderarzt, der vermutete, dass sie betroffen ist, und sie zur Abklärung schickte. «Plötzlich verstand ich, warum ich so bin, wie ich bin», sagt sie. «Schon als Kind merkte ich, dass mit mir etwas nicht stimmt.» Sie habe alle anderen genervt, war vorlaut, habe Leute brüskiert. «Obschon ich das nicht wollte.» Es sei einfach passiert, sagt Tamara. Mediziner reden von mangelnder Impulskontrolle – eines der Kennzeichen im Gesamtbild ADHS. Hinzu kommen eine kurze Konzentrationsspanne, hohe Reizbarkeit, Bewegungsdrang. Rund fünf Prozent der Kinder leiden daran. Bei einigen verschwinden die Symptome mit der Pubertät, bei den meisten bleiben sie bestehen: So haben vier Prozent der Erwachsenen hierzulande ADHS. Doch die Ärzteschaft und erst recht die Öffentlichkeit sind sich dessen kaum bewusst.
Öfter verletzt, häufiger süchtig
Die Betroffenen leben im Dauerstress. Viele suchen Ausgleich bei Risikosportarten oder gehen generell hohe Risiken ein. Wer ADHS hat, hat mehr Unfälle als der Durchschnitt, und er verletzt sich öfter. Und erwachsene ADHSler entwickeln häufig psychische Störungen. So zeigt bis zu einem Drittel antisoziales Verhalten oder emotionale Instabilität. Bei etwa einem Fünftel sind es Angststörungen. Zwei Drittel landen in einer Sucht. Das Risiko für eine Alkoholabhängigkeit ist gemäss verschiedenen Studien bei Menschen mit ADHS im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung dreifach erhöht. Für Drogenmissbrauch achtfach, bei Tabak neunfach. «Sie brauchen die Substanzen zur Selbstmedikation», sagt Monika Ridinger, ehemalige Chefärztin im Zentrum für Suchtpsychiatrie und -psychotherapie bei den Psychiatrischen Diensten Aargau und heute selbstständige Psychiaterin mit spezialisierter ADHS-Sprechstunde. «So schlecht diese Personen ihre Impulse kontrollieren können, so schlecht haben sie auch ihren Substanzkonsum im Griff.» Darum ist die ADHS-Therapie bei Kindern und erst recht bei Erwachsenen auch Suchtprävention.
Auch der Lehrer Peter S.* wusste schon als Kind, dass er anders ist. Er benahm sich immer wieder unpassend und wurde dafür von den Mitschülern gehänselt, bald auch geprügelt. «Mein Selbstvertrauen war bei null», erinnert er sich. Als eine Lehrerin vorschlug, das Kind abzuklären, hätten sich die Eltern heftig dagegen gewehrt. Das Thema war in der Familie ein Tabu und ist es in vielen anderen heute noch.
Peter war nie süchtig nach Substanzen, nur nach Abwechslung. So stürmt er seit Jahren von Hobby zu Hobby. «Interessanterweise kann ich mich auf diese Aktivitäten gut konzentrieren», sagt er. Was er tut, tut er intensiv, geradezu exzessiv, bis ihm wieder langweilig wird. Entsprechend schwierig war die Berufswahl. In keiner Schnupperlehre hielt er es aus, dann fand er seinen Traumberuf: Lehrer. «Weil keine Stunde wie die andere ist – und jeder Tag eine neue Herausforderung.»
Langer Weg zur richtigen Therapie
Die Ausbildung hat er geschafft, doch im Beruf war er unsicher, fragte sich fortwährend, ob er es recht macht. Auf die Idee, dass er ADHS haben könnte, ist er erst gekommen, als einer seiner beiden Söhne abgeklärt wurde. «Da merkte ich, dass viele Befunde auch auf mich zutreffen.» Die Diagnose sei eine Erlösung gewesen. Doch bis zur richtigen Therapie war es eine Odyssee: mehrere Psychiater, verschiedene Medikamente, die Suche nach der richtigen Dosis, der Umgang mit Nebenwirkungen. «Bei Erwachsenen sind die Medikamente schwieriger einzustellen als bei Kindern», erklärt Monika Ridinger. Peter hat es geschafft. «Die Psychotherapie hat mich gestärkt, aber ohne Medikamente wäre mein Leben ein Dauerstress.»
Obschon ihr Sohn Johannes regelmässig Ritalin nimmt, versucht Tamara T., ohne auszukommen – das Medikament hat sie nur für den Notfall dabei. Viel lieber klettert sie auf einen Baum, wenn ihr alles zu viel wird. «Die Leute sollen mich akzeptieren, wie ich bin», sagt sie. «Schliesslich ist mein ADHS Fluch und Segen zugleich.» Beispielsweise spüre sie sofort, wie es Menschen geht. Darum ist sie auf dem Wochenmarkt, wo sie Olivenöl verkauft, äusserst beliebt. Sie findet für jeden die richtigen Worte.
Kommunikativ, kreativ und mutig
Tatsächlich lassen sich viele Merkmale von ADHS auch positiv interpretieren, sagt Michael von Rhein. Schwatzhaftigkeit als Kontaktfreude, Risikobereitschaft als Mut, Chaotentum als Kreativität, Überempfindlichkeit als Sensibilität. Letzteres betont auch der Lehrer Peter S. Er sagt von sich, er habe ein besonderes Sensorium. «Ich sehe einem Kind in die Augen und weiss, ob es ADHS hat – oft lange vor der ärztlichen Diagnose.» Seine Schüler lieben ihn. Bei diesem Lehrer läuft immer was. Dass er ADHS hat, wissen sie nicht.
Zur Weissglut bringt ihn heute nicht mehr so viel – höchstens die Diskussion um ADHS und Ritalin. «Warum weigern sich Eltern, ihrem Kind ein Medikament zu geben, das ihm hilft?», fragt er. «Würden sie das bei einer Infektionskrankheit auch tun? Am meisten leidet das unbehandelte Kind.» Er rät auch jedem Erwachsenen, der sich «nicht richtig» fühlt, zur Abklärung. Welches dann die richtige Therapie ist, entscheiden die Lebensumstände. Für Tamara T., die vor allem Hausfrau und Mutter ist, hat der Befund nicht viel verändert, für den Lehrer Peter S. war er essenziell. «Therapie und Medikamente haben aus mir einen positiven und sicheren Menschen gemacht», sagt er. Endlich fühle er sich «richtig».
*Namen von der Redaktion geändert.