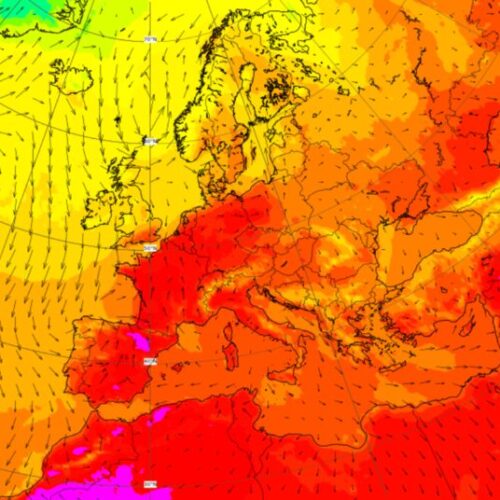Das musst du wissen
- Das Weissbuch beleuchtet die klinische Forschung in der Schweiz auf und formuliert sieben Ziele, um diese zu stärken.
- Unter anderem sollen, wie in anderen Ländern, Betroffene vermehrt einbezogen werden.
- Dank einer nationalen Plattform soll der Austausch zwischen Hauptakteuren verbessert und Redundanzen vermieden werden.
Herr Bassetti, was war der Auslöser für diesen Bericht?
Die Initialzündung war eine Beobachtung aus den 1990er-Jahren, dass die klinische Forschung in der Schweiz zwar auf einem guten Niveau ist, aber nicht so stark wie beispielsweise die Grundlagenforschung. Damals sagte man bereits, dass es in der klinischen Forschung Dinge gibt, die entwickelt werden müssen, damit die Schweiz auch auf diesem Gebiet ein führendes Land wird. Im Jahr 2020 fragten wir uns, ob wir noch im Rückstand sind oder aufgeholt haben. Gewisse Elemente haben sich verbessert, aber wir sind weiterhin der Meinung, dass das Land immer noch im Silodenken steckt und es besser machen könnte.


Claudio Bassetti
Hat die Pandemie das System unter Druck gesetzt?
Das Coronavirus hat uns die Bedeutung der klinischen Forschung und die Grenzen des Systems, in dem wir leben, vor Augen geführt. Es zeigte, dass wir multidisziplinär arbeiten und Forschungsdaten mit weniger schwerfälligen Formalitäten teilen müssen, und dass man Dinge mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit erledigen kann. Corona hat uns viele Lektionen erteilt, auch im Bereich der klinischen Forschung. Die Systeme, die am besten auf die Krise reagierten, waren diejenigen, die nicht nur über Spitzenforschende verfügten, sondern auch über die politische Fähigkeit, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen.
Haben Sie Beispiele für mögliche Verbesserungen in der klinischen Forschung?
Alle reden beispielsweise davon, wie wichtig es ist, Patientinnen und Patienten einzubeziehen. Aber das muss schon bei der Planung klinischer Studien berücksichtigt werden. Es ist sehr wichtig, Beurteilungskriterien zu haben, die nicht nur klinisch sind, sondern auch Rückmeldungen von Betroffenen über die Lebensqualität oder die Verbesserung ihrer Fähigkeiten einschliessen. In meinem Fachgebiet wird erwartet, dass ein Antiepileptikum die Zahl der Anfälle um fünfzig Prozent reduziert. Aber was bedeutet das für die Kranken? Viel wichtiger ist es für sie, wieder arbeiten zu können oder ein soziales Leben zu führen.
Klinische Forschung: Wer macht was?
- Universitätsspitäler, unter anderem jenes in Genf (HUG) oder Lausanne (CHUV), Forschungsinstitute wie Unisanté in Lausanne oder das Institut für Sozial- und Präventivmedizin (ISPM) in Bern und die Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Lausanne (EPFL) oder Zürich (ETHZ und Paul Scherrer Institut), wo die meisten klinischen Forschungsprojekte durchgeführt werden.
- Im Jahr 2007 wurden sechs klinische Forschungszentren gegründet, die an Universitätsspitäler angegliedert sind, um bewährte Praktiken zu verbreiten und die Anfänge einer Koordinierung zu schaffen, die von der Swiss Clinical Trial Organisation (SCTO) umgesetzt wird.
- Der Schweizerische Nationalfonds (SNF), der im Auftrag des Bundes Forschungsprogramme finanziert, ist die wichtigste öffentliche Finanzierungsquelle. Gemäss einem Bericht investiert der SNF jährlich rund sechzig Millionen Franken in die klinische Forschung – weniger als zehn Prozent seines Gesamtbudgets.
- Seit 2017 arbeitet das Swiss Personalized Health Network (SPHN) daran, eine grundlegende Infrastruktur für den Austausch von Gesundheitsdaten zwischen Institutionen zu schaffen. Dasselbe gilt für die Swiss Biobanking Platform (SBP) für biologische Proben.
Sie sprechen auch von der Notwendigkeit, die klinische Forschung attraktiver zu machen – und gehen sogar so weit, medizinische Fachpersonen, die forschen, als eine «gefährdete Spezies» zu bezeichnen.
Alle sagen, dass junge Leute gebraucht werden, aber es ist sehr schwierig, in der Schweiz eine Karriere als «clinical scientist», also klinischer Wissenschaftler zu machen. Um beispielsweise Neurologe oder Kardiologin zu werden, muss man ein von der Fachgesellschaft anerkanntes Studium absolvieren, und das ist lang und kompliziert. Einige Fachgesellschaften haben mit Unterstützung der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH ihre Anforderungen angepasst, um die Forschung besser zu integrieren, andere sind jedoch zurückhaltender.
Der zweite Punkt ist die Finanzierung. Ein Assistent verdient heute, wenn er Forschung betreibt, weniger als ein reiner Kliniker. Es ist eine Doppelkarriere – Klinik und Universität –, das ist schwieriger, und trotzdem verdient er weniger. Deshalb hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften ein spezielles Programm ins Leben gerufen, um junge Ärztinnen und Ärzte zur Forschung zu ermutigen.
Es gibt auch die Idee, dass Forschende für ihre Fähigkeit, mit anderen zusammenzuarbeiten und ihre Daten zu teilen, anerkannt und belohnt werden sollten. Denn ehrgeizige Forschende, die sehr egoistisch und erfolgreich für sich selbst arbeiten, sind nicht das, was man in der klinischen Forschung braucht. Die Kunst ist «ich», die Wissenschaft ist «wir», wie der französische Arzt und Physiologe Claude Bernard sagte. Und es muss auch Platz für Nicht-Mediziner geben, zum Beispiel für Ingenieurinnen und Pflegefachleute. In Bern, wo ich Dekan der Fakultät bin, haben wir viele Ingenieure. Sie sind es, die uns Kompetenzen im Bio-Engineering vermitteln.
Die Kultur der klinischen Forschung sollte in der Schweiz entwickelt werden. Was soll das bedeuten?
In den Niederlanden zum Beispiel wissen Kranke, wenn sie in einem Universitätsspital sind, dass dort Forschung betrieben wird. Klinische Forschung ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Natürlich werden sie gefragt, ob sie damit einverstanden sind. Bei uns gibt es jedoch ein kulturelles Problem, das dazu führt, dass die Teilnahme an einer klinischen Studie eher die Ausnahme als die Regel ist. Die niederländischen Betroffenen wissen, dass es wichtig ist, sich zu beteiligen, um die Wissenschaft voranzubringen. Wenn wir forschen, können wir sie besser behandeln, denn wir sind auf dem neuesten Stand und damit besser und genauer informiert.
Sie erwähnen auch Krankenhausleitungen, die sehr auf die Rentabilität bedacht sind.
Es gibt ein Problem bei den Universitätskliniken. Sie erkennen die Bedeutung von Lehre und Forschung an, aber unter finanziellem Druck tritt die klinische Forschung manchmal in den Hintergrund. Das Management eines Krankenhauses sollte immer das Wort «klinische Forschung» im Munde führen, am häufigsten fällt aber das Wort «Geld» (Pflege ist viel rentabler als Forschung, Anm. d. Red.).
Der wichtigste Vorschlag des Berichts ist die Schaffung einer nationalen Koordinierungsplattform für die klinische Forschung. Denken Sie dabei an eine grosse, zentralisierte Einrichtung, wie die Forschungseinrichtung Inserm in Frankreich oder das Nationale Gesundheitsinstitut NIH in den Vereinigten Staaten?
Wir denken dabei nicht an eine grosse zentrale Einrichtung, sondern vielmehr daran, dass die verschiedenen Akteure der klinischen Forschung nicht zu unabhängigen «Silos» werden oder darin bleiben. Denn das führt zu Doppelspurigkeiten und höheren Kosten. Die Idee ist ein besser koordinierter Ansatz auf nationaler Ebene.
Die Expertengruppe hat gut zusammengearbeitet. Am Anfang war es nicht einfach, weil wir sehr unterschiedliche Hintergründe haben, aber am Ende war die Atmosphäre sehr freundschaftlich und kooperativ. Das Ziel wäre, in diesem Sinne weiterzumachen, um über eine schweizerische Plattform zu verfügen, die das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI bei den Entscheidungen unterstützt, wo die Ressourcen eingesetzt werden sollen und ihm die möglichen Synergien sowie das Risiko von Doppelspurigkeiten aufzeigt.
Ist dies in Planung?
Ja, das SBFI hat der Akademie den Auftrag erteilt, eine solche Plattform einzurichten. Die Arbeiten werden im Dezember 2021 beginnen. Wir haben zwei bis drei Jahre Zeit, um einen konkreten Vorschlag zu machen, was diese Plattform tun und wie sie organisiert werden könnte. Es liegt auf der Hand, dass diese Plattform, wenn sie Einfluss haben soll, auf lange Sicht Entscheidungskompetenzen haben muss. Wir wollen keinen «Schwatzklub».
Wie wird sie heissen?
Wir haben viel über den Namen diskutiert und beschlossen, ihm vorerst keinen Namen zu geben. Wir wollen vorsichtig sein, wir kennen unser Land!
Heidi.news