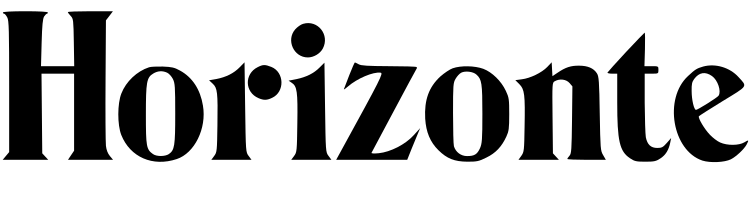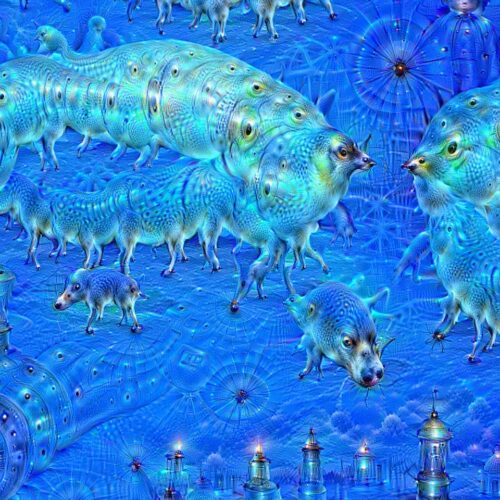Zwei Athletinnen treten gegeneinander an – unter den gleichen Bedingungen. Es könnte ein spannender Wettkampf werden. Über Sieg oder Niederlage entscheiden Motivation, Disziplin und Willenskraft. Das ist es, was Millionen von Zuschauenden immer wieder in die Stadien oder an den Bildschirm lockt.
«Fairness bedeutet eigentlich nur, dass in einem Wettbewerb für alle die gleichen Regeln gelten.»Alexandre Mauron, Bioethiker
Doch vielleicht lässt sich das Publikum hier täuschen: Oft bestimmt nicht die persönliche Leistung, sondern die Ausrüstung, das Trainingsprogramm oder schlichtweg die richtige genetische Veranlagung darüber, wer am Ende die Nase vorn hat. Wann ein Wettkampf gerecht ist, darüber gehen auch unter Forschenden die Meinungen auseinander.
Doping – Medikamente zum Nachteilsausgleich?
Da ist zum Beispiel Erythropoetin (Epo), eine Substanz, die natürlicherweise im Körper vorkommt, die Produktion von roten Blutkörperchen anregt und so die Sauerstoffaufnahme und die Leistungsfähigkeit erhöht. Radsportler, die von Natur aus mehr Epo produzieren, sind deshalb klar im Vorteil. Wäre es nicht fair, ihnen die zusätzliche Einnahme dieser Substanz zu erlauben – damit sie nicht von Anfang an mit einem Rückstand an den Start gehen?
«Fairness bedeutet eigentlich nur, dass in einem Wettbewerb für alle die gleichen Regeln gelten», sagt Alexandre Mauron, emeritierter Professor für Bioethik an der Universität Genf. Nach dieser Definition ist beides fair: die Einnahme von Epo generell zu verbieten oder generell zu erlauben. Nicht fair wäre es dagegen, nur einige wenigen – von der Natur benachteiligten – Radfahrern das künstliche Kompensieren zu gestatten. Zumindest aus ethischer Sicht sei ein erlaubtes Doping unter medizinischer Aufsicht vertretbar, so Mauron. «Andere Sportarten wie Boxen oder Base-Jumping gefährden die Gesundheit ebenfalls. Es ist gesellschaftlich akzeptiert, dass mündige Erwachsene selbst entscheiden dürfen, welche Risiken sie eingehen. Die Frage ist natürlich legitim, ob diese breite Akzeptanz selbst ethisch vertretbar ist, aber mit Fairness hat dies nichts zu tun.»
Das sieht der Sportphysiologe und ehemalige Radsporttrainer Raphaël Faiss ganz anders. Als Forschungsmanager des Center of Research and Expertise in Anti-Doping Sciences an der Universität Lausanne sucht er nach besseren Nachweismethoden für verbotene Substanzen. «Eine Funktion des Sports in unserer Gesellschaft ist doch auch, unseren Kindern zu vermitteln, dass man ein Ziel durch Arbeit und Disziplin erreichen kann», sagt er. Dies durch das Schlucken von Pillen abzukürzen, ist für ihn schlichtweg nicht akzeptabel.
«Durch Antidoping-Massnahmen geben wir Sportlerinnen, die hart trainieren, eine faire Chance zu gewinnen», so Faiss. Komplett liesse sich Doping zwar nie verhindern, doch das Netz sei in den letzten Jahren viel engmaschiger geworden. Für vertretbar hält er indes zum Beispiel das Training in höheren Lagen, das ebenfalls die Produktion von roten Blutkörperchen ankurbelt. «Im Unterschied zu Doping erfordert dies auch einen gewissen Einsatz vonseiten der Athletinnen, und es geschieht auf natürliche Weise.» Jemand, der es nicht auf natürlichem Wege schafft, einen genetischen Nachteil auszugleichen, muss also auf eine Karriere als Spitzensportlerin verzichten.
Geschlecht – Wer darf bei den Frauen mitlaufen?
Doch das Argument der Natürlichkeit reicht nicht immer aus, um gerechte Regeln aufzustellen. Dies zeigt der Fall der Südafrikanerin Caster Semenya, die erfolgreich Mittelstrecken läuft. Viele von Semenyas Konkurrentinnen fühlten sich im Wettbewerb ihr gegenüber benachteiligt, denn sie hat aufgrund einer Variante der Geschlechtsentwicklung einen erhöhten Testosteronspiegel.
Die Frage, ob sie dennoch bei den Frauen mitlaufen darf, beschäftigte den Internationalen Sportgerichtshof über Jahre. Das Schweizer Bundesgericht bestätigte im Jahr 2020 eine Regel des Internationalen Leichtathletikverbands, die für Mittelstreckenläuferinnen eine Testosteron- Obergrenze von fünf Nanomol pro Liter Blut festlegt. Frauen, bei denen Intersexualität festgestellt wurde, haben die Option, ihren Testosteronspiegel durch Hormoneinnahme zu senken. Ob diese Regel wirklich dazu geeignet ist, Sportlerinnen der richtigen Geschlechtskategorie zuzuordnen, ist umstritten. Sportphysiologe Faiss räumt ein, dass es für eine Rechtfertigung dieser Regel keine eindeutige wissenschaftliche Grundlage gibt: «Es ist sicher nicht ideal, die Klassifikation an einer einzigen Substanz festzumachen.» Doch Testosteron sei eine sehr effektive leistungssteigernde Substanz, und zudem gebe es bei dessen Konzentration eine klare Lücke zwischen Männern und Frauen, sodass sich diese Einteilung anbiete.
«Ist es uns wichtig, eine Chancengleichheit herzustellen, die auf ein einziges Charakteristikum wie Testosteron abzielt und einige Frauen ausschliesst?»Lena Holzer, Rechtswissenschaftlerin
Als eine Alternative sieht Faiss eine neue Kategorie im Sport für Personen, deren Testosteronspiegel sich zwischen Frau und Mann bewegt. «Diese Frauen wollen nicht abgesondert in einer alternativen Kategorie antreten, sondern in Frauenwettbewerben mitstreiten», sagt dagegen die Rechtswissenschaftlerin Lena Holzer, die am Graduate Institute in Genf und am King’s College London über Genderfragen im Sport promoviert. «Da können wir noch so viele wissenschaftliche Studien machen, es ist auch die Frage, was für ein Bild von Gerechtigkeit im Sport wir haben», so Holzer. «Ist es uns wichtig, eine Chancengleichheit herzustellen, die auf ein einziges Charakteristikum wie Testosteron abzielt und einige Frauen ausschliesst? Oder wollen wir einen Sport, der inklusiv ist und die verschiedensten Bevölkerungsgruppen repräsentiert?»
Dafür müsse auch ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, glaubt Holzer. So könnte bei Sportveranstaltungen beispielsweise statt des Wettbewerbs wieder mehr die Kooperation in den Vordergrund gestellt werden, so wie dies schon erfolgreich bei den Olympischen Jugendspielen praktiziert wird: Dort treten zum Beispiel beim Curling gemischte internationale Teams aus Mädchen und Jungen gegeneinander an. Im Vordergrund steht dabei das gemeinsame Erlebnis.


Werde jetzt higgs-Member und erhalte gratis ein Exemplar des Doping-Thrillers «Lauf um mein Leben»
Werde Basic-Member bei higgs, schicke einen Screenshot deiner Anmeldebestätigung an membership@higgs.ch – und du erhältst gratis ein Exemplar des Buchs. Hier Member werden.
Ausrüstung – Bestimmen Schuhe über Goldmedaillen?
Doch in den meisten Sportwettbewerben geht es nach wie vor um Siege und Rekorde. Und dass hier eine innovative Technik den Athleten einen entscheidenden Vorteil bringen kann, ist kein Geheimnis: So sorgte in den letzten Jahren ein neuartiger Laufschuh für Furore. Dank eines speziellen Schaums und einer eingebauten Karbonplatte in der Sohle erhalten die Läufer mehr Energie vom Auftritt zurück und sparen so etwa vier Prozent.
Solche kleinen Effekte können im Laufsport, wo es oft nur auf Bruchteile von Sekunden ankommt, einen Riesenunterschied machen, sagt der Biomechaniker Jess Snedeker von der Universität und der ETH Zürich. Tatsächlich sorgte der Schuh in den letzten Jahren für zahlreiche neue Rekorde. Läuferinnen mit anderen Sponsoren hatten das Nachsehen. Neben der richtigen Ausrüstung kann aber die Genlotterie den entscheidenden Unterschied zwischen Amateursportler und Superstar ausmachen.
«Eigentlich feiern wir Sportstars also auch für ihr Genom und den Zugang zur besten Technologie.»Jess Snedeker, Biomechaniker
Das Team von Snedeker hat vor Kurzem eine Genvariation entdeckt, die Sehnen mehr Steifheit verleiht, sodass sie wie die neuen Schuhe mehr elastische Energie speichern können. Die Träger des Gens können daher mehr als 13 Prozent höher springen als andere Menschen. Snedeker vermutet, dass diese Genvariation etwa bei professionellen Basketballspielern und Sprinterinnen überrepräsentiert ist. Zu seinem Bedauern verweigerte ihm die amerikanische National Basketball Association jedoch die Erlaubnis, bei ihren Spielern Gentests durchzuführen. Es ist aber bekannt, dass Menschen aus Westafrika – von wo viele Elitesportlerinnen stammen – überdurchschnittlich oft dieses Gen tragen.
«Eigentlich feiern wir Sportstars also auch für ihr Genom und den Zugang zur besten Technologie», so Snedeker. Derartige Ungleichheiten werden bis jetzt in Wettkämpfen nur wenig berücksichtigt, doch der norwegische Sportphilosoph Sigmund Loland hat einen Lösungsansatz: In Sportarten, bei denen die Ausrüstung eine entscheidende Rolle spielt, soll das Equipment standardisiert sein, ähnlich wie jetzt schon im Segelsport. Und körperliche Eigenschaften, die Sportler durch eigene Anstrengung nicht wesentlich beeinflussen können – wie etwa Grösse oder Testosteronspiegel –, sollen durch Klassifizierung oder Handicaps ausgeglichen werden. So könnte es im Basketball verschiedene auf der Körpergrösse basierende Klassen geben. Dieses Prinzip kommt jetzt schon im Behindertensport zum Einsatz, wo es eine Klassifizierung und Handicaps aufgrund verschiedener körperlicher Fähigkeiten gibt, um allen Konkurrentinnen die gleiche Ausgangschance zu geben.
«Im Ringen hat jede Gewichtsklasse einen eigenen Stil, und gerade das macht es interessant.»Jess Snedeker, Biomechaniker
Snedeker findet diesen Vorschlag grundsätzlich nicht schlecht und könnte sich vorstellen, dass dadurch viele Sportarten sogar attraktiver würden: «Im Ringen hat beispielsweise jede Gewichtsklasse einen eigenen Stil, und gerade das macht es interessant.» Wenn es dagegen nur noch um die beste Ausrüstung oder die richtige genetische Veranlagung gehe, mache das Zuschauen keinen Spass mehr.
Dies ist auch für den Ethiker Alexandre Mauron der Knackpunkt: «Die wichtigste Frage ist letztlich, ob das Wesen des Sports erhalten bleibt. Findet der Wettbewerb noch zwischen den Sportlerinnen statt oder aber zwischen versteckten Mitstreiterinnen in pharmakologischen Labors oder in Entwicklungsabteilungen der Sponsoren?» Denn das will dann wirklich niemand mehr sehen.
Horizonte Magazin