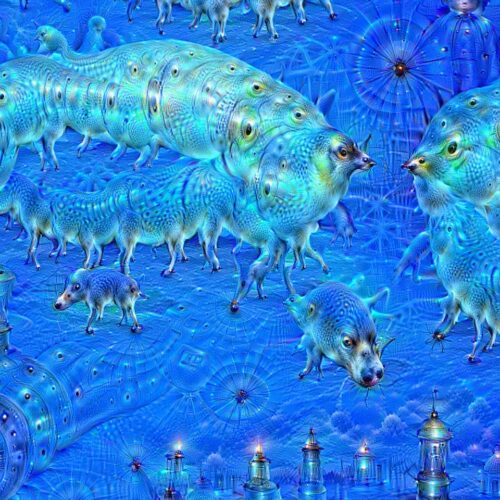Melissa* war auf dem Weg zum Hallenbad, als ein kurzer Gedanke sie zum Stehenbleiben zwingt. Sie spürt ihr Herz, das immer stärker pocht. Aus dem einen Gedanken werden schlagartig viele, wild durcheinandergeworfene Gedankenfetzen. Melissa kann sie nicht mehr lenken, geschweige denn ausschalten. «Ich kam den wirren Gedanken einfach nicht mehr nach. Ich hatte Angst», erklärt die junge Frau rückblickend. Der Atem wird flattrig, das Herz rast, die Gedanken spulen weiter. In Melissa steigt Übelkeit auf, sie hat das Gefühl ohnmächtig zu werden. Sie nimmt immer weniger von ihrer Umgebung wahr und die Angst in ihr, die wird immer grösser. Eine Angst, welche Melissa seit mehreren Jahren immer wieder attackiert, schlagartig und überall. Es ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst vor dem Scheitern, die Angst davor, den eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. «Im Grunde genommen ist es schlichtweg die Angst vor mir selbst», erklärt die 25-Jährige.
Abschlussarbeiten Wissenschaftsjournalismus
higgs unterstützt Ausbildung. Deshalb bringen wir hier in einer Serie die diesjährigen Abschlussarbeiten des CAS Wissenschaftsjournalismus der Schweizer Journalistenschule MAZ. Hier findest du die Ausschreibung des nächsten Kurses.
Nach der Ruhe kam die Panik
Die junge Frau erzählt ihre Geschichte ganz ruhig. Von Zeit zu Zeit starrt sie aus dem Fenster des kleinen Cafés im Industrieviertel von Zürich auf die Limmat, wo wir sitzen. Während sie beobachtet, wie eine Ente gegen die Strömung kämpft, nippt sie an ihrem Blaubeer-Eistee. Dabei rutscht der Ärmel ihres etwas zu grossen Wollpullovers nach hinten und gibt den Blick frei auf das Handgelenk, das ein Tattoo einer Zitrone ziert. Ein Symbol für Sizilien, Melissas zweite Heimat. Der Ort, wo sie sich oft hin sehnt. Es ist aber auch der Ort, wo alles begonnen hat.
_____________
Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️
_____________
Nach zwei Jahren voller Aufbruch und Umbruch in Zürich, dem Beginn des Studiums an der ETH, dem Abbruch noch während dem ersten Semester, verschiedenen Gelegenheitsjobs, durchtanzten Nächten in Clubs, spontanen Kurztrips in Europa und Reisen nach Südamerika, ist Melissa im Herbst 2016 mit ihrer Familie nach Sizilien gereist in der Hoffnung, dort endlich einmal zur Ruhe zu kommen. Die Ruhe kehrte ein. Doch sie war zu viel für die junge Frau. «Plötzlich hatte ich ganz viel Zeit zum Nachdenken. Kaum war ich zurück in Zürich, hatte ich nur noch Angst vor allem», sagt sie. Von da an haben Panikattacken Melissas Alltag bestimmt.
Angst – die häufigste psychische Krankheit
Melissas Geschichte ist kein Einzelfall. Laut einer Kampagne von Pro Infirmis aus dem Jahr 2016 leiden etwa jeder zehnte Schweizer und jede zehnte Schweizerin im Laufe ihres Lebens einmal an einer Angststörung. «Das sind mehr Betroffene als solche, die an einer Depression leiden», sagt Josua Jung. Der Psychotherapeut des Amubulatorium Römerhofes hat sich auf Angststörungen spezialisiert und weiss: Angst kann jeden treffen. Und auf unterschiedlichste Arten. Doch eins haben die Formen der Angststörungen gemeinsam: sie alle verursachen bei den Betroffenen erhebliches Leiden und beeinträchtigen das Leben.
Grundsätzlich unterscheiden sich die verschiedenen Angststörungen durch die Reize, welche die unangenehmen Zustände bei den Betroffenen auslösen. So gibt es die Angst, im Mittelpunkt zu stehen und bewertet zu werden (soziale Phobie), die Angst nicht von einem Ort flüchten zu können oder keine rechtzeitige Hilfe zu erhalten (Agoraphobie), allgemeine übermässige Sorge (generalisierte Angststörung), die wahrgenommene Bedrohung durch exakte Orte oder Tiere (spezifische Phobie), die Angst, eine Bezugsperson zu verlieren (Trennungsangst) oder eben die unbegründet aufkommende Angst (Panikstörung). Das typische an Panikstörungen ist, dass sie die Betroffenen oftmals unerwartet und schlagartig einholen. Meist dauert ein Anfall nur wenige Minuten.
Die Krankheit beginnt im Hirn
Um zu verstehen, was bei einer Panikattacke im Hirn vorgeht, lohnt sich der Blick auf den normalen Angst-Mechanismus. Über das Gehirn wird der ganze Organismus in Alarmbereitschaft versetzt. Der Puls steigt, die Atmung wird schneller, der Körper ist bereit zum Kampf oder zur Flucht. Entpuppt sich der erste Reiz als Fehlalarm oder ist die Gefahrensituation vorbei, gibt der Hippocampus Entwarnung und der Mandelkern beruhigt sich wieder. Somit entspannt sich auch der Körper: der Puls senkt sich und die Atmung wird langsamer. Liegt aber irgendwo in dieser ganzen Dynamik ein Fehler, kann es zu einer Panikattacke kommen. Dies kann beispielsweise ein falsch wahrgenommener Reiz oder schlichtweg die Fehleinordnung des Reizes sein. Verschiedene Studien konnten nachweisen, dass bei Betroffenen, die an einer Panikstörung leiden, der Mandelkern eine erhöhte Aktivität aufzeigt. Anstatt den Fehlalarm zu stoppen, registriert dann nämlich der Mandelkern die selbst ausgelösten Stresssymptome als gefährlich und verstärkt deren Bekämpfung mit noch stärkeren Mitteln. Die Spirale beginnt und die Symptome wirken sich auf den ganzen Körper aus.
Lernen, mit dem Feind zu leben
Panikattacken sind heftig. Aber sie sind behandelbar. Und noch besser: die Heilungschancen sind laut Jung sehr hoch. Der Therapeut betont aber, dass gar nicht jede Panikstörung professionell therapiert werden muss. «Genauso, wie nicht jeder Mensch bei einer Grippe zum Arzt geht, braucht nicht jeder Paniker einen Psychologen zur Hilfe», sagt Jung. Wenn die Störung aber lange anhält oder die Betroffenen nicht genügend eigene Ressourcen aufbringen können, macht laut Jung eine professionelle Therapie durchaus Sinn. «Das können auch nur wenige Stunden sein», sagt Jung. In solchen Stunden lernen die Patienten zum Beispiel Wege, sich mit ihren Ängsten zu konfrontieren. Die Therapie knüpft an verschiedene Punkte der Angstwahrnehmung und -empfindung an, immer da, wo der Patient die geringsten eigenen Mittel aufbringen kann.
Im Kampf gegen die eigene Angst
Im Expositionstraining beispielsweise lernen Betroffene, ihr eigenes Verhalten zu ändern. Dabei setzen sie sich wiederholt Situationen aus, in welchen sie Panikattacken erlebt haben und welche sie dadurch meiden. Zuerst nimmt der Betroffene wieder erste Angstreize wahr, doch versucht er nun nicht mehr, panikmässig darauf zu reagieren, sondern zu lernen, dass die Situation eigentlich zu meistern ist. «Nur durch das stetige Auseinandersetzen mit der eigenen Angst lernt der Körper, dass die Angst in Wahrheit unbegründet ist», erklärt Jung die Therapieform. Das Hirn speichert dann dieses positive Erlebnis ab und greift in wiederkehrenden Situationen auf dieses zurück – und nicht mehr auf das negative. Mit Hilfe der Expositionstherapie hat auch Melissa gelernt, wieder ins Hallenbad zu gehen. Sie weiss, dass sie jederzeit auch nach weniger als einem Kilometer aus dem Wasser steigen kann.
Anker setzen
Melissa presst den Zeigfinger auf den Daumen und bildet so einen Kreis. Eine Methode, die ihr hilft, ihren Körper und ihre Umgebung besser wahrzunehmen und erste Anzeichen von Panikattacken besser zu deuten. Indem sie die beiden Finger fest aufeinanderdrückt, ruft Melissa positive Gedanken ab, die sie früher mit dem Aufeinanderpressen verankert hat, so genannte positive Trigger. Das wiederholte Anker setzen ist eine Methode der kognitiven Verhaltenstherapie. Sie besagt, dass die Art und Weise wie wir denken, einen entscheidenden Einfluss auf unser Verhalten hat. «Mir helfen solche Übungen, bewusst immer wieder mein momentanes Befinden wahrzunehmen», erklärt Melissa.
Nicht immer hält der Anker bei Melissa. Alle zwei bis drei Monate wird sie von einer Panikattacke eingeholt. «Ich habe gelernt, solche Attacken einfach über mich ergehen zu lassen.» Das sei der einfachste Weg. Das Studium hat Melissa jedoch bis heute nicht wieder aufgenommen. «Die Angst, meinen eigenen Ansprüchen im Studium nicht zu genügen, die ist noch zu gross», sagt sie dazu.
Die Angst akzeptieren
Melissa zieht durchaus Positives aus den Attacken: «Ich habe noch nie so gut geschlafen wie nach einer Panikattacke», lacht sie. Die unglaubliche Erschöpfung und die grosse Leere, es gäbe kein schöneres Einschlafen. Die Attacken haben sie aber auch gezwungen, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzten. «Ohne sie würde ich nicht an diesem Punkt stehen, wo ich jetzt bin.» Durch das Reflektieren der zahlreichen Attacken habe sie nicht nur an Selbstreife gewonnen, sie sei auch viel offener gegenüber Menschen geworden, welche mit psychischen Krankheiten zu kämpfen haben. Sie wünscht sich aber, dass öffentlich offener mit Ängsten umgegangen werden kann und die Gesellschaft genauer darüber aufgeklärt wird, was es heisst, an einer Panikstörung oder anderen psychischen Krankheit zu leiden.