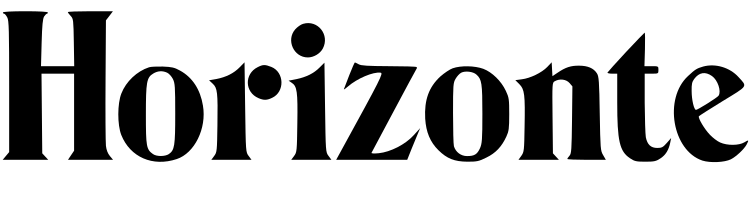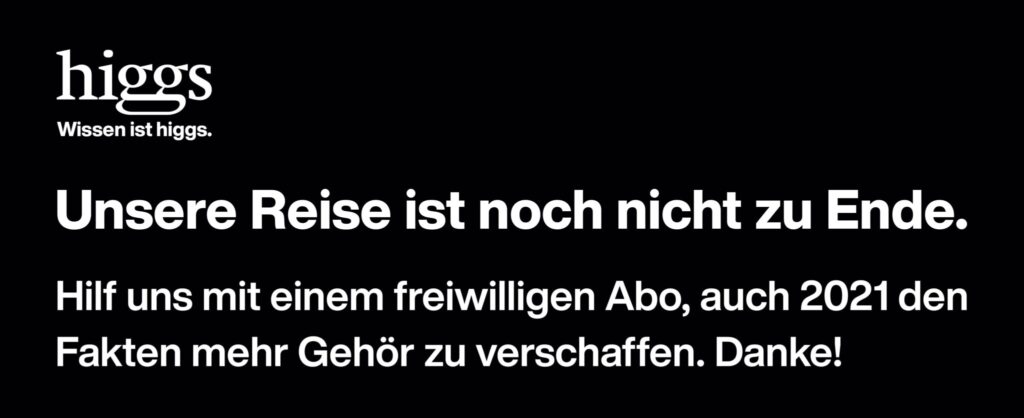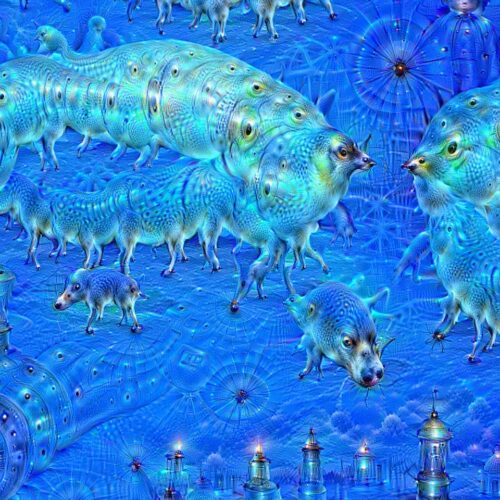Kaffee ist krebserregend, sagten Studien – falsch, weiss man heute. Wer Eigelb isst, erhöht seinen Cholesterinspiegel, sagten Studien – falsch, weiss man heute. In der Ernährungswissenschaft finden sich so einige Studienresultate, die sich später als Irrtum entpuppten. Warum aber ist es so schwierig, aus Ernährungsstudien eindeutige Aussagen zu ziehen?
Sabine Rohrmann, Ernährungswissenschaftlerin an der Universität Zürich, antwortet mit einer Gegenfrage: «Was haben Sie gestern gegessen?» Ob es abends einen Hamburger, ein veganes Gemüserisotto oder einen Salat gab, daran erinnert man sich vielleicht noch. Aber was war alles im Gemüserisotto drin? Und in der Salatsauce?
«Was haben Sie gestern gegessen?»
So entpuppt sich die scheinbar simple Frage rasch als kompliziert. Sie veranschaulicht eines der grössten Probleme von Ernährungsstudien: Die Datenerhebung ist unsicher, weil sie auf Angaben von Studienteilnehmenden beruht. So leiden die Daten unter dem sogenannten Self-Report Bias, also Verzerrungen, die entstehen, weil Testpersonen falsche oder unvollständige Angaben machen – aus schlechtem Gewissen oder schlicht, weil Dinge unbewusst vergessen gehen. Wer gibt schon gerne an, dass er nicht eines, sondern zwei Kuchenstücke verdrückt hat. Wer erinnert sich an das Guetzli, das es im Restaurant zum Kaffee gab, geschweige denn an den genauen Zeitpunkt der Einnahme.
«Wir kennen das Problem natürlich und versuchen, es mit unseren Befragungsmethoden aufzufangen», sagt Rohrmann. Zum Beispiel fragen die Forschenden separat nach bestimmten Lebensmitteln, etwa nach Fleisch oder Süssem, und sie zeigen Portionsgrössen zur Auswahl, um dem Gedächtnis der Probanden auf die Sprünge zu helfen. Dennoch sind die Falschangaben zum Teil drastisch. Beispielsweise zeigte sich bei der grossen US-amerikanischen «National Health and Nutrition Examination Study», dass die angegebene Kalorienaufnahme unrealistisch tief war. Mit so wenigen Kalorien könnten die Studienteilnehmenden gar nicht überleben.
Dem Erinnerungsvermögen nachhelfen
Nicht nur das Essverhalten der Menschen ist komplex, sondern auch die Lebensmittel selbst sind es. Käse aus der Schweiz hat andere Inhaltstoffe als französischer Käse, dasselbe gilt für Fertigprodukte verschiedener Anbieter. «Uns ist klar, dass wir die Daten nicht aufs Gramm genau aufnehmen können», sagt deshalb Rohrmann. Sie reichen jedoch, um Vergleiche zwischen verschiedenen Ernährungsweisen zu ziehen und so Hinweise zu erhalten, welche Ernährung sich wie auswirkt.
Bewegung und Bildung nicht vergessen!
Dazu ist es nötig, die weiteren Faktoren einzubeziehen, die unsere Gesundheit mitbeeinflussen – und dies zum Teil deutlich stärker als die Ernährung. Beispielsweise ob wir rauchen, viel Alkohol trinken oder uns genug bewegen, ob wir einen hohen Bildungsstand haben sowie weitere soziokulturelle Faktoren, die sich kaum messen lassen. In der Praxis können die Forschenden die Daten nie um alle Störfaktoren korrigieren. Diese Störfaktoren führen zusammen mit den oben beschriebenen Verzerrungen in der Datenerhebung zu Unsicherheiten – zu einem Hintergrundrauschen in den Daten, in dem Effekte untergehen können. Umgekehrt kann es vorkommen, dass zufällige Zusammenhänge aus diesem Datenrauschen auftauchen, die sich in nachfolgenden Studien nicht bestätigen lassen.
«Grundsätzlich sollte man die Ergebnisse einzelner Beobachtungsstudien nicht überbewerten», sagt darum Murielle Bochud, Ernährungsforscherin und Epidemiologin an der Universität Lausanne und Mitglied der eidgenössischen Ernährungskommission, die den Bundesrat in Ernährungsfragen berät. «Sie sind immer nur ein Puzzleteil eines sehr komplexen Bildes.»
Genauere Ergebnisse können sogenannte Interventionsstudien liefern. Ähnlich wie in Studien in der Medizin wird dabei der Effekt einzelner Massnahmen mit Testpersonen und einer Vergleichsgruppe untersucht. So ermöglichen sie nicht nur herauszufinden, ob zum Beispiel ein Zusammenhang zwischen Salz und Bluthochdruck existiert, sondern erlauben eine Aussage darüber, ob Salz tatsächlich die Ursache ist.
«Interventionsstudien lassen sich generell nicht lange durchhalten, weil die Motivation der Probanden mit der Zeit nachlässt.»Murielle Bochud, Ernährungsforscherin und Epidemiologin
Allerdings ist es schwierig, solche Studien sauber durchzuführen. Um zu untersuchen, wie sich eine bestimmte Lebensmittelgruppe – zum Beispiel rotes Fleisch oder Gemüse – auf die Entstehung von Krankheiten auswirkt, müssten Ernährungsforschende jahrzehntelange Studien mit Tausenden zufällig ausgewählten Probanden und einer repräsentativen Kontrollgruppe durchführen. Doch das ist weder praktikabel noch ethisch vertretbar. «Interventionsstudien lassen sich generell nicht lange durchhalten, weil die Motivation der Probanden mit der Zeit nachlässt», sagt Bochud. Zudem können die Forschenden nur beschränkt nachprüfen, wie diszipliniert die Probanden den Anweisungen der Studie folgen. So sind selbst Interventionsstudien mit Unsicherheiten behaftet.
_____________
Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️
_____________
Für die Forschenden gibt es neben den praktischen Schwierigkeiten aber auch noch einen gewissen Anreiz, aus den Daten möglichst viel herauszupressen. «Nicht umsonst gibt es in der Statistik-Community den Ausspruch: Torture the data until they confess», sagt David Fäh, Ernährungswissenschaftler an der Berner Fachhochschule. Denn mit einem statistisch signifikanten Zusammenhang lässt sich eine Studie in einer prestigeträchtigeren Fachzeitschrift publizieren. Und daran wird der wissenschaftliche Erfolg gemessen, davon hängen Karrieren ab. «Wir sollten versuchen, uns von diesem Publikationsdruck in der Wissenschaft zu emanzipieren», findet Fäh, räumt aber ein, dass das für ihn als Titularprofessor einfacher ist als für Nachwuchsforschende, die sich noch etablieren müssen.
Fäh selbst ist während seiner Karriere immer vorsichtiger geworden. Als Beispiel nennt er eine Studie, die er vor einigen Jahren durchgeführt hat. Es ging um die Frage, ob ein hoher Cholesterinspiegel auch in der Schweiz mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten verbunden ist. Zwar konnte Fäh einen Zusammenhang nachweisen, doch nur bei sehr hohen Cholesterinwerten und nur bei gezielten Einschränkungen bei der statistischen Auswertung. Fäh wählte stattdessen eine breitere Sicht und erhielt dadurch ein weniger spektakuläres, aber dafür realistischeres Ergebnis, wonach der Zusammenhang weder klar noch allgemeingültig ist.
Methodische Mängel: Studie zurückgezogen
Mitunter ist es also einfach, mit Tricks zu einem statistisch signifikanten und scheinbar aussagekräftigen Ergebnis zu kommen. «Ein Mittel, um das zu verhindern, wäre schlicht mehr Transparenz», sagt Fäh. «Es ist wichtig, dass Studienautoren angeben, wie sie mit der Grenze zwischen statistisch signifikant und nicht signifikant umgehen.»
Ein prominentes Negativbeispiel war in diesem Zusammenhang eine grosse Untersuchung zu den Auswirkungen einer mediterranen Ernährung von 2013. Die Predimed-Studie fand klare Vorteile einer Ernährung mit viel Olivenöl, Hülsenfrüchten und Fisch und wurde zunächst begeistert aufgenommen. Als die Autoren aber erst Jahre nach der Publikation auf Druck der Forscher-Community Details zu ihrer Methodik preisgaben, offenbarten sich mehrere methodische Mängel. Von den Ergebnissen blieb wenig übrig.
Dass dies kein Einzelfall ist und sich tatsächlich viele Studienergebnisse in Luft auflösen, hat der US-amerikanische Epidemiologe und prominente Kritiker von Ernährungsstudien John Ioannidis vor einigen Jahren aufgezeigt. Er hatte sich aus Kochbüchern aufs Geratewohl 50 Zutaten ausgesucht. Von diesen waren 40 bereits in über 260 Einzelstudien zu ihrem Krebsrisiko untersucht worden. Von diesen Studien hatten über 70 Prozent einen Einfluss auf das Krebsrisiko gefunden – teilweise mit sich widersprechenden Befunden. Unter anderem waren Rindfleisch, Brot und Tomaten mal für ein erhöhtes, mal für ein vermindertes Krebsrisiko verantwortlich.
«Der Einfluss einzelner Lebensmittel ist derart klein, dass er, verglichen mit anderen Faktoren, schlicht nicht ins Gewicht fällt.»Hannelore Daniel, Ernährungsphysiologin
In einem zweiten Schritt schaute sich Ioannidis zu den 40 Zutaten nur die Metaanalysen an, also Übersichtsstudien, welche die Ergebnisse aller zuvor durchgeführten Einzelstudien abhängig von deren Qualität miteinbeziehen. Nur noch weniger als 30 Prozent dieser Metaanalysen fanden einen – meist nach unten korrigierten – Einfluss auf Krebserkrankungen.
Inzwischen halten viele Ernährungsforschende es denn auch für überzogen, einzelne Nahrungsmittel – egal ob Fleisch, Nüsse oder Butter – für unsere Gesundheit oder eine Krankheit verantwortlich zu machen. «Der Einfluss einzelner Lebensmittel ist derart klein, dass er, verglichen mit anderen Faktoren, schlicht nicht ins Gewicht fällt», sagt Hannelore Daniel, Ernährungsphysiologin und emeritierte Professorin der Technischen Universität München.
Enorme individuelle Unterschiede
Unter diese anderen Faktoren fällt nicht zuletzt auch, dass wir Menschen nicht gleich auf Lebensmittel reagieren. So hat Daniel gezeigt, dass individuelle Unterschiede schon bei einem einfachen Glukosebelastungstest auftreten. Dabei trank eine homogene Gruppe von Probanden ein Glas Wasser mit Traubenzucker. Über die nächsten Stunden stieg bei einem Drittel der Probanden der Zuckerspiegel im Blut an wie im Lehrbuch. Bei einem Drittel aber kletterte er nur um die Hälfte und bei einem weiteren Drittel blieb er gar unverändert. «Warum das so ist, wissen wir noch nicht», sagt Daniel.
Solche individuellen Unterschiede werden heute intensiv erforscht. Noch steht die personalisierte Ernährung am Anfang. Aber Daniel hält es für wahrscheinlich, dass in Zukunft individuelle Ernährungsempfehlungen einen Nutzen bringen. Die Forscherin könnte sich etwa eine App vorstellen, die im Supermarkt bei Kaufentscheiden hilft. Die Empfehlungen würden allerdings nicht nur aufgrund gesundheitlicher Kriterien, sondern auch, und das findet die Ernährungsforscherin ebenso wichtig, auf ökologischen Gesichtspunkten beruhen.
Horizonte Magazin