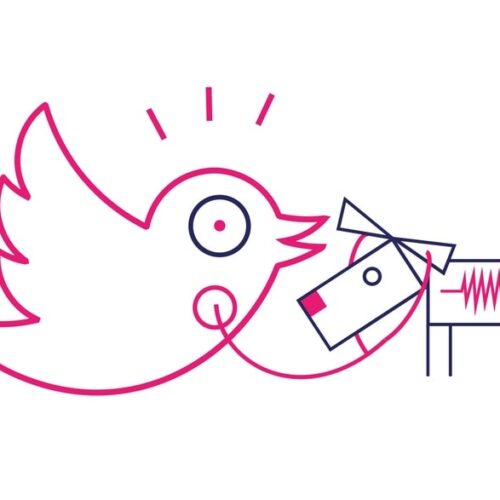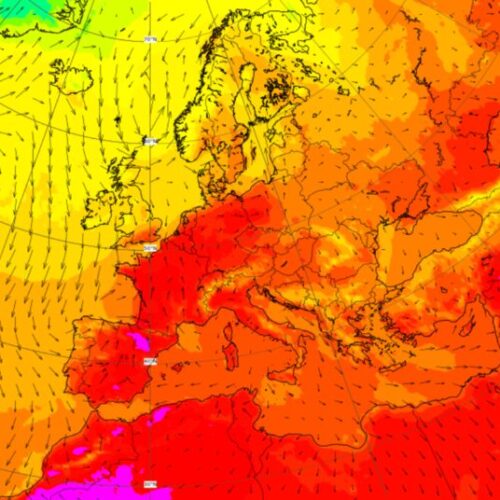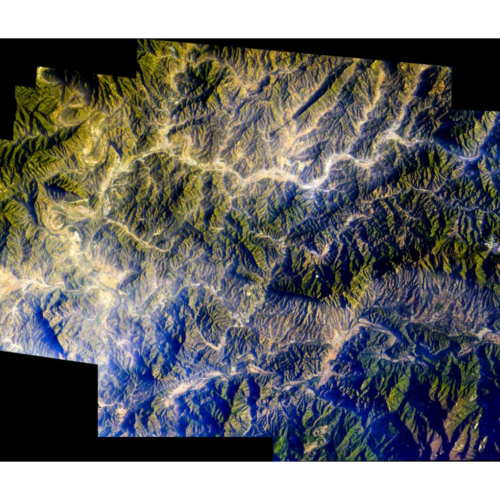Angela Birchler bietet uns Kaffee und Tee an. Der Wasserkocher brodelt, so wie wir es von zu Hause kennen. Doch diese Tasse Ingwertee ist etwas Besonderes: Sie wurde aus aufbereitetem Regenwasser und mit Strom aus der Solaranlage gekocht.


Angela Birchler beim Kaffeekochen.
Birchler wohnt mit ihrer Freundin zur Probe im «KREIS-Haus», einem nahezu autarken Wohnhaus für ein bis zwei Personen. Die beiden Frauen helfen damit der Forschung, denn das Haus wurde als Versuchslabor für ökologisches Bauen und Wohnen konzipiert.


Die Wege im «KREIS-Haus» sind kurz.
Birchler ist Baubiologin und damit eine ideale Testperson. Sie probiert nicht nur aus, ob es sich im «KREIS-Haus» komfortabel wohnen lässt, sondern sie achtet auch auf baubiologische Aspekte. So misst sie während unseres Besuchs immer mal wieder die elektrischen und magnetischen Felder.
Was gefällt den beiden Frauen am meisten? «Das Raumklima ist dank natürlicher Baustoffe sehr angenehm», sagt Birchler. Als wir das Haus betreten, riecht es nach Holz. Dass die Frauen am Vorabend Crevetten mit Knoblauch gebraten haben, davon erfahren wir nur aus ihrer Erzählung, Gerüche zeugen keine davon. Obwohl es keinen Dampfabzug hat, funktioniert die Entlüftung über das Badezimmer sehr gut.


Grossen Gefallen finden die beiden Frauen auch an der Autarkie: Dass das Haus unabhängig von der Kanalisation ist, dass das Grauwasser genutzt und der benötigte Strom mittels installierter Solaranlage selbst produziert wird. «Die Autarkie war ein wichtiger Grund, weshalb wir das KREIS-Haus besuchen wollten, weil wir selber ein autarkes Haus bauen wollen», so Birchler.


Unter den semitransparenten Solarmodulen verbirgt sich ein Wintergarten zum Gemüseanbau.
Und wo sehen sie Verbesserungspotential? «Beim Elektrosmog durch die Ausstattung!», sind sich die beiden Frauen einig. Tatsächlich sind hier einige technische Besonderheiten verbaut: Das Licht ist zentral gesteuert, die Türen schliessen automatisch und das Wasser stellt unmittelbar ab, wenn man die Hände zurückzieht. Damit wird Strom und Wasser gespart, respektive die Wärme im Wohnraum gehalten. Das finden die beiden Frauen gut. Aber sie würden zusätzliche elektrobiologische Optimierungen begrüssen.
Was ist skalierbar?
Entwickelt hat das «KREIS-Haus» die Umweltingenieurin Devi Bühler von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW). Sie will ausprobieren, wie sich Material-, Energie-, Wasser-, und Nährstoffkreisläufe in Wohnhäusern optimal schliessen lassen. Bei ihrem Musterhaus entstehen keine Abfallstoffe, alles wird genutzt. Aus recycelten Glasscherben wurde ein Fussboden, aus Fäkalien wird Dünger und aus Regen Duschwasser.


Die Forscherin Devi Bühler in ihrem klimafreundlichen Kleinhaus.
Häuser zu bauen und zu betreiben, verursacht vierzig Prozent des weltweiten CO2-Ausstosses. Bühler ist überzeugt, dass es mit weniger ginge. Ihr geht es bei ihrer Forschung auch um einen gesellschaftlichen Wandel. Mit ihrem Haus möchte sie zeigen, dass ressourcensparendes Wohnen keineswegs mit einem Verlust der Lebensqualität einhergehen muss. Sie ist mit grossen Immobilienfirmen in Kontakt, die umwelt- und klimafreundlicher bauen wollen und die Forschungsergebnisse mit Spannung erwarten. «Es geht um technische Machbarkeit, finanzielle Tragbarkeit und soziale Akzeptanz», sagt Bühler.
Aber welche Technologien und Ideen des klimafreundlichen Hauses wären skalierbar? Das haben wir zusammen mit Bühler, weiteren Fachpersonen und den beiden Testbewohnerinnen eruiert:
Passivhaus: Ausrichtung zur Sonne und dicke Isolation
Diese Techniken sind bereits in internationale und schweizerische Labels und Zertifizierungen eingeflossen. Ein Problem gibt es aber: Je dicker die Dämmung, desto weniger Wohnraum verbleibt.


Blick von oben hinunter in den Wohnbereich.
Übergestülpter Wintergarten als Heizung
«Die Baugesetze sind in der Schweiz kantonal geregelt. Je nach Kanton und Zonenordnung kann ein Wintergarten realisiert werden, oder eben nicht», sagt Bühler. Der Glasüberbau nehme zusätzlichen Platz ein, sei aber nicht ganzjährig nutzbar. «Eine Testbewohnerin war zunächst Feuer und Flamme und wollte auch so einen Wintergarten bauen», erzählt Bühler. «Als sie merkte, dass dadurch Wohnfläche von ihrem sonst schon kleinen Haus verloren geht, musste sie von der Idee absehen.» Bühler findet, es brauche eine einheitliche Regelung, die festlegt, dass der Wintergarten rechtlich nicht zum Wohnraum zählt, da er eine Pufferzone, ja eigentlich ein kleines Kraftwerk bilde und die Kreislauffähigkeit am Gebäude umsetze.
Eine andere Herausforderung stellt das neblige Schweizer Mittelland. «Wenn es im Winter über mehrere Wochen Hochnebel hat, müssen wir auf die zusätzliche Infrarotheizung zurückgreifen», räumt Bühler ein. Diese wird mit Solarstrom vom Dach und aus den Batterien betrieben. Dieser Strom reiche zeitweise nicht aus, vor allem im Januar und Februar. «Dann müssen wir Strom vom Netz beziehen. Diesen speisen wir aber im Sommer wieder ein. Über das Jahr produzieren wir etwa vier Mal mehr Solarstrom, als das Haus benötigt.» Im sonnigen Alpenraum hingegen bräuchte das «KREIS-Haus» laut Bühler keinen Stromanschluss.


Die semitransparenten Solarmodule auf dem Dach sorgen für interessante Lichtspiele.
Trocken-Trenn-Toilette statt Kanalisation
Eine Genossenschaft bei Genf hat in einem Mehrfamilienhaus Kompost-WCs eingebaut. «Es braucht Disziplin», meint Bühler zum Modell, das sie im «KREIS-Haus» verbaut hat. Nach dem Stuhlgang müssen die Bewohnenden eine Pedale betätigen, sodass der Kot auf einem Förderband weggeführt wird. Kein Problem, finden die beiden Testpersonen. Bühler könnte sich vorstellen, das Förderband zu automatisieren, um die Handhabung weiter zu vereinfachen. So könnte man die Toilette auf Knopfdruck betätigen und müsse nicht selber treten.
Dennoch werden Trocken-Trenn-Toiletten in der Schweiz kaum zum neuen Standard: Jedes Haus muss von Gesetzes wegen einen Wasser- und Abwasseranschluss haben. Diese Regel wurde aus hygienischen Gründen eingeführt, man wollte die Verbreitung von Krankheiten und Umweltverschmutzungen verhindern. «Die Schweizer Gesetzgebung hinkt der Realität hinterher», meint Bühler. Mit hauseigenen Reinigungsmethoden ist das Kanalisations-Obligatorium eigentlich obsolet.
Und die hausinterne Wasseraufbereitung wäre sogar wirtschaftlich – würden die Behörden keine Anschlussgebühren erheben. «Die Gebühren entsprechen in etwa den Anschaffungskosten», so Bühler. «Mit den gesparten Wasserkosten kann danach der Betrieb finanziert werden.»
Es stecken jedoch handfeste finanzielle Interessen hinter den bestehenden Gesetzen, wie mehrere Fachleute unisono bestätigen, darunter Forscherin Devi Bühler, Martin Vinzens vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE sowie auch der Verein Kleinwohnformen, der sich in der Schweiz dafür einsetzt, dass Bauwagen, Tiny Houses, Jurten und Co. als anerkannte Wohnformen akzeptiert werden. Die Gemeinden haben für viel Geld eine Kanalisation, Wasserleitungen und Kläranlagen gebaut und müssen diese amortisieren. «Die Gemeinden haben eine Erschliessungspflicht, sie müssen die Leitungen bis zu jedem Bauland-Grundstück verlegen», erklärt Vinzens. Wenn dann einige die Leitungen gar nicht nutzen, sind die Grundkosten nicht gedeckt.
Dazu kommt laut Bühler die Frage der Kontrolle: Wenn jeder seine eigene kleine Kläranlage im Haus betreibt, wer überwacht die Einhaltung der Hygiene? Für die Gemeinden wäre das aufwändig und teuer. Aber auch dieses Problem ist laut Bühler lösbar: «Es wären Regulationen vorstellbar, die definieren, wie der Private die Sicherheit gewährleisten und den Nachweis dafür erbringen kann. Es muss nicht zwingend die Gemeinde machen.»
Besonders vielversprechend ist die Technik für Länder, in denen aufgrund weiter Distanzen nicht überall alle Häuser an die Kanalisation angeschlossen sind, etwa in Australien oder den USA. Dort könnten Wurmkomposte anstelle von Tanksystemen oder Sickergruben interessant sein.


Die Trocken-Trenn-Toilette ist etwas gewöhnungsbedürftig.
Wasser aufbereiten und wiederverwenden
Diese Technik ist laut Bühler für Länder mit Wasserproblemen deutlich attraktiver als für die Schweiz, die als Wasserschloss Europas gilt. Aber auch hierzulande lohne sich die Wiederverwendung von Abwasser, damit die Nährstoffe nicht verloren gingen. «Wenn der Kreislauf nicht geschlossen wird, haben wir irgendwann eine Ressourcenknappheit.» Zudem werde es aufgrund des Klimawandels auch in der Schweiz regional und temporal zu Wasserknappheit kommen. «Trinkwasser für die WC-Spülung zu verwenden, ist eine Verschwendung», sind sich Birchler und Bühler einig.
Auch Vinzens vom Bundesamt für Raumentwicklung ARE findet den Nutzen des Wasserkreislaufs eigentlich eine gute Sache. In manchen Gebäuden würden Toiletten bereits mit Regenwasser gespült. «Früher gab es teilweise Probleme der sozialen Akzeptanz: Manche Leute empfanden das Wasser als schmutzig, vor allem bei Algenbildung oder Verfärbungen. Das hat sich aber bereits erheblich verbessert.»
Doch was autarke Wassersysteme betrifft, ist die Schweiz laut Bühler nicht fortschrittlich. Laut Vinzens sind autarke Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung in der Schweiz noch kein Massenphänomen. Wenn immer mehr Leute diese wollten und etwa ganze Quartiere und Siedlungen keine Anschlüsse mehr bräuchten, dann könnte dies auch für die Gemeinden attraktiv werden und zu Gesetzesänderungen führen.
Bühler ärgert sich über dieses Argument: «Wie sollen die Leute denn etwas machen können, wenn es gar nicht erlaubt ist? Ich kenne unzählige Beispiele, wo Siedlungen und Hauseigentümer eine eigene Wasserversorgung machen wollten, aber es wurde seitens der Behörden nicht erlaubt.»


Das Bad ist gemütlich eingerichtet.
Recyceltes Baumaterial verwenden
Laut Vinzens vom ARE ist der Gebrauch von recycelten Baustoffen bei grösseren Objekten schwierig. «Wenn Sie eine grössere Überbauung planen, finden Sie nicht genügend passende Occasion-Baustoffe. Oder nur mit riesigem logistischem Aufwand.» Zudem müsse bereits beim Baugesuch angegeben werden, welche Materialien man verwenden wolle. Das wisse man zu diesem Zeitpunkt aber noch gar nicht, das hänge ja davon ab, was man an der Bauteilbörse überhaupt finde.
«Genau deshalb braucht es regulatorische Anpassungen, um die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Die Lösungen stehen alle bereit, wir müssen sie nur umsetzen», findet Devi Bühler.


Devi Bühler setzt auf nachhaltige Baumaterialien.
Bau auf Stelzen und Verzicht auf Unterkellerung
Devi Bühler wollte den Boden minimal beeinträchtigen. Deshalb steht das «KREIS-Haus» auf einem betonlosen Schraubfundament, ähnlich wie ein Pfahlbau. Der Boden wird nicht versiegelt, das Haus kann später entfernt und der Boden wieder bepflanzt werden.
Trotzdem ist Vinzens vom ARE wenig überzeugt: «Ein mehrstöckiges Mehrfamilienhaus ist ideal für verdichtetes Bauen, aber ein solches kann man nicht auf Stelzen stellen.» Zudem sollte man aus seiner Sicht den Kellerraum nutzen, der Raumverlust wiege schwerer als die Treibhausgase von Aushub und Kellerbau. «Dass der Boden nicht versiegelt wird, stimmt nicht ganz, denn die Erde verliert an Qualität, wenn sie keine Sonnenstrahlen und keinen Regen abbekommt.»
Ganz anders sieht das Devi Bühler: «Bis vier Stockwerke ist diese Technik auch bei Mehrfamilienhäusern möglich», so die Forscherin. Und die Luftzufuhr unter dem Haus sei gut für die Biodiversität, viele Insekten und Kleintiere fänden dort einen Lebensraum. Beim herkömmlichen Hausbau lande die ausgehobene Erde häufig auf der Deponie. «Das ist ein Verlust von wertvollem Boden.»


Um den Boden minimal zu beeinträchtigen, steht das Haus auf Stelzen.
Wohnen auf kleinem Raum: Tiny House
Wenn es denn überhaupt möglich ist: «Ein Tiny House anstelle eines Einfamilienhauses – dafür bekommt man in den meisten Gemeinden keine Baubewilligung», so Vinzens. Das Land würde «unternutzt» werden. Auch die Banken geben kaum Hypotheken, die Investition ist ihnen zu riskant.
Dabei gäbe es laut Bühler durchaus sinnvolle Einsatzgebiete für Tiny Houses: Für Zwischennutzungen auf Industriebrachen oder zum verdichtenden Bauen, indem beispielsweise Gärten bei Einfamilienhäusern für zusätzlichen Wohnraum genutzt würden und so weiter.
Dennoch seien es nicht unbedingt Tiny Houses an sich, die sich für den breiten Einsatz eigneten, durchaus aber die Frage: «Brauchen wir so viel Platz?» Durch multifunktionale Nutzung lasse sich der Raumbedarf auch im Mehrfamilienhaus reduzieren.
Das «KREIS-Haus» ist denn auch ein Testlabor für «reduziertes Wohnen». Bühler wollte kein Camping-Feeling aufkommen lassen, deshalb gibt es einen echten Glaskeramikherd und einen Miniatur-Backofen. «Ich habe eine hochwertige, aber reduzierte Einrichtung einbauen lassen», so Bühler. Bei den zunehmenden Single-Haushalten durchaus ein erfolgversprechendes Konzept.


Bei der Einrichtung wurde viel auf Stauraum und Gemütlichkeit geachtet.
Wenn vieles so einfach ist, warum tut sich dann in der Schweiz so wenig?
Der Status Quo sei zu bequem, meint Bühler. Die Ausbildungen seien veraltet. «Die meisten Architektur-Studiengänge fokussieren darauf, wie ein ästhetisches Gebäude erstellt werden kann. Nachhaltigkeit spielt eine untergeordnete Rolle.»
Laut Bühler bräuchte es ein Umdenken und die Förderung auf allen Ebenen. Beispielsweise durch Zuschüsse für Mehrkosten bei umweltfreundlichen Um- und Neubauten, flexiblere Planungs- und Bauprozesse sowie Massnahmen, um Marktversagen zu korrigieren.