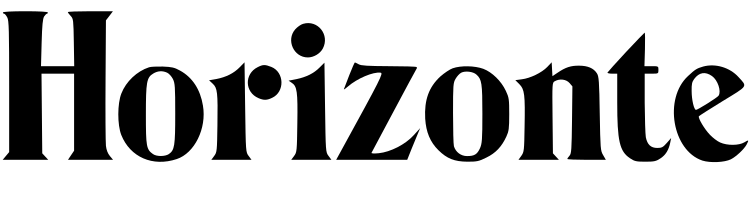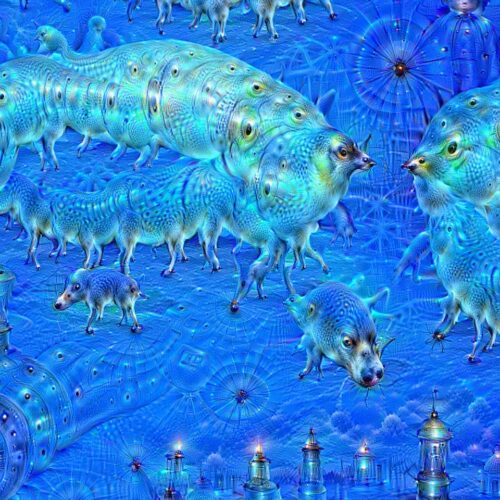Als der Patient, nennen wir ihn Michael Keller, in den Notfall des Universitätsspitals Zürich eingeliefert wurde, konnte er kaum noch atmen, weil sich um seine Lunge Flüssigkeit angesammelt hatte. Die Ärzte führten eine Punktion durch, um die Lunge zu entlasten. Bei der Analyse der Flüssigkeit fanden sich bösartige Krebszellen. Eine Computertomografie zeigte zudem Schatten in der Lunge, vermutlich Metastasen. Zu diesem Zeitpunkt wussten Michael Keller – sein Name ist zwar erfunden, er selbst und seine Erkrankung sind aber echt – und seine Ärzte zwei Dinge: erstens, dass Keller Krebs hat. Zweitens, dass die Situation ernst ist. Der Krebs hatte bereits Ableger gebildet – noch vor zwanzig Jahren ein Todesurteil.
Zwar konnten Ärztinnen schon damals Tumore unter dem Mikroskop charakterisieren. «Daraus erhielten sie Informationen über das Ursprungsorgan, die Art und Aggressivität des Tumors und erste Hinweise für die Therapie», erklärt Andreas Wicki, leitender Onkologe am Universitätsspital Zürich. Doch diese war bei metastasierten Tumoren kaum erfolgreich: Alle Krebsarten eingerechnet, überlebten im Jahr 2000 nur knapp fünf Prozent der Patienten in fortgeschrittenem Stadium. Heute überleben zwanzig Prozent der Menschen mit Metastasen – dank personalisierter Therapien.
Die ersten menschlichen Genome brachten Hoffnung
Inzwischen verraten nämlich die Gene häufig, wo die Ursache eines Tumors liegt und wie man diesen am besten behandelt. «Krebs entsteht meist dadurch, dass sich das Erbgut im Laufe des Lebens verändert», sagt Wicki. Diese Veränderungen können Fachleute in Schweizer Spitälern heute dank moderner DNA-Sequenziermethoden sichtbar machen. Dazu wird das Erbgut der Tumorzellen analysiert. Je nach Krebsart werden 50 bis 400 Gene angeschaut, von denen man weiss, dass sie krebsfördernde Mutationen enthalten können.
Solche genetischen Analysen gehören heute etwa bei Hautkrebs, Brustkrebs oder Lungenkrebs zum diagnostischen Standard. Durch sie lassen sich zum Beispiel bei Lungenkrebs rund zehn Tumor-Untergruppen unterscheiden und personalisiert behandeln. So erhalten Menschen, bei denen das Tumorwachstum durch eine Mutation eines Proteins namens Epidermal Growth Factor Receptor angetrieben wird, ein Medikament, das genau dieses Protein hemmt. Kranke mit einer Mutation der sogenannten Tyrosinkinase RET erhalten einen RET-Hemmer.
«Krebs entsteht meist dadurch, dass sich das Erbgut im Laufe des Lebens verändert.»Andreas Wicki
Bei Patientinnen, deren Tumore keine der behandelbaren Treibermutationen aufweisen, setzen Onkologinnen Immuntherapie ein oder eine Kombination aus Immuntherapie und Chemotherapie. Möglich sind solche gezielten Therapien heute, weil Forschende in den frühen 2000er-Jahren, nachdem die ersten menschlichen Genome entschlüsselt worden waren, anfingen, den Einfluss genetischer Unterschiede zu untersuchen und zielgerichtete Wirkstoffe zu entwickeln.
Auch Patient Keller erhielt eine Woche nach seiner Einlieferung das Ergebnis der genetischen Analyse. Es zeigte, dass er an Hautkrebs leidet und dass sich seine Krebsform am besten mit Immuntherapie behandeln lässt. Seither erhält er alle drei Wochen eine Infusion mit einem sogenannten Checkpoint-Inhibitor. Diese Wirkstoffe beeinflussen Regulationsproteine des Immunsystems und bewirken, dass dieses anfängt, Tumorzellen zu bekämpfen.
Noch klappt es bei vielen Krankheiten nicht
Die allermeisten Erkrankungen und Behandlungen unterscheiden sich von Mensch zu Mensch: Wir leiden nicht gleich stark unter den Nebenwirkungen von Medikamenten, tragen andere Risiken für Herz-Kreislauf- und viele weitere Erkrankungen und bekommen bei Infektionen verschieden starke Symptome. Die personalisierte Medizin will diese individuellen Ausprägungen nutzen, um die Behandlung jedes Einzelnen zu verbessern. Bei den Patienten angelangt sind personalisierte Therapien bisher erst bei manchen Krebsarten und gewissen seltenen Krankheiten wie zystischer Fibrose. Sie bergen aber ein riesiges Potenzial, um vielen weiteren Patienten zu helfen.
Jüngstes Beispiel ist Covid-19. «Längst nicht alle schweren Verläufe waren durch das Alter oder durch Vorerkrankungen erklärbar», sagt Jacques Fellay, Direktor der Einheit für Präzisionsmedizin am Universitätsspital Lausanne. Er hat zusammen mit einem internationalen Team untersucht, warum auch viele junge, zuvor kerngesunde Menschen nach der Infektion beatmet werden mussten oder gar starben. Dazu analysierten die Forschenden die Antikörper und die Erbinformation von rund 1500 Patienten in Intensivstationen auf fünf Kontinenten. So entdeckten sie bestimmte Mutationen, die Proteine der Immunantwort ausschalten und die Patienten anfällig für die Infektion machen. «Damit können wir rund zwanzig Prozent der untypischen schweren Fälle erklären», sagt Fellay. In seinem Team untersucht er ebenfalls, warum bei einem kleinen Teil der HIV-Patienten die Infektion auch ohne Medikamente unter Kontrolle blieb oder wieso Menschen unterschiedlich auf das Hepatitis-B-Virus reagieren.
«Längst nicht alle schweren Verläufe von Covid-19 waren durch das Alter oder durch Vorerkrankungen erklärbar.»Jacques Fellay
Um solche Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung künftig für die Therapie von Patientinnen nutzen zu können, müssen Forschende biologische und genetische Variationen nicht nur erkennen, sondern auch deren Einfluss auf eine Erkrankung verstehen. «Um hier Fortschritte zu machen, brauchen wir vor allem viel mehr nutzbare Daten als bisher», sagt Fellay. Doch in der Schweiz gebe es Hürden.
Das sagt auch Christiane Pauli-Magnus, Co-Leiterin des Departements klinische Forschung an der Universität und dem Universitätsspital Basel. Als Konsiliarärztin in der Rheumatologie sieht sie täglich die Grenzen der heutigen Medizin. In ihrem Fachbereich gibt es nur wenige Behandlungsmethoden, die alle bei manchen Patienten wirken und bei anderen nicht. «Warum, wissen wir nicht», sagt Pauli-Magnus. So bleibt nichts übrig, als eine Therapie nach der anderen auszuprobieren. «Wenn wir stattdessen die Ursachen verstehen würden, könnten wir den Patienten schneller helfen, ohne sie mit unnötigen Therapien zu belasten.»
«Wenn wir die Ursachen verstehen würden, könnten wir den Patienten schneller helfen, ohne sie mit unnötigen Therapien zu belasten.»Christiane Pauli-Magnus
Die angesprochenen Hürden sehen Pauli-Magnus und Fellay bei der Datensammlung und der Datennutzung. Zunächst zur Datensammlung: Im Wesentlichen stammen Patientinnendaten aus zwei Quellen: klinischen Studien und Routinedaten der Spitäler. Letztere entstehen bei der Behandlung von Patientinnen und umfassen etwa Vitalwerte, Laborwerte, Aufnahmen aus der Bildgebung, kurz: die gesamte Krankengeschichte. Diese Informationen werden lokal und geschützt in den Spitälern gespeichert.
«Das sind wertvolle Daten, die wir unbedingt nutzen sollten», sagt Pauli-Magnus. Wenn man Patienten fragt, ob sie ihre medizinischen Daten zur Weiterverwendung für Forschungszwecke freigeben möchten, ist die Bereitschaft gross: Acht von zehn sagen ja. Doch das Problem ist: Nur ein Bruchteil wird überhaupt gefragt.


Veraltet? Wer seine Daten zur Forschung freigeben will, muss dem handschriftlich zustimmen.
Mittelalterliche gesetzliche Vorgaben
Das liege zu einem grossen Teil daran, dass Patientinnen hierzulande ihre Zustimmung noch mit einer Unterschrift auf Papier geben müssen, sagt Pauli-Magnus. Das mache den Prozess kompliziert, vor allem, wenn die Patienten schon wieder daheim sind. «Werden die Formulare per Post nach Hause geschickt, landen sie häufig im Altpapier», sagt Pauli-Magnus. «In einer digitalen Welt, in der wir ohne Bedenken private Bilder und Daten unverschlüsselt ans andere Ende der Welt schicken, ist diese gesetzliche Vorgabe der Handschriftlichkeit geradezu mittelalterlich.» Sie wünschte sich stattdessen den sogenannten EConsent: Damit könnten Behandelte ihre Zustimmung elektronisch geben.
Die zweite Hürde liegt in der fehlenden Einheitlichkeit der Routinedaten. Das gilt schon für scheinbar simple Dinge wie die Bezeichnung des weiblichen und des männlichen Geschlechts. Dieses kann man nämlich unterschiedlich codieren als: Mann/Frau, m/w, male/female, m/f und so weiter. So lassen sich Daten aus verschiedenen Spitälern kaum vergleichen.
Um Lösungsansätze für dieses Problem kümmert sich seit fünf Jahren das Swiss Personalized Health Network (SPHN), eine vom Bund finanzierte Initiative. Die SPHN-Fachleute haben ein Netzwerk mit Universitätsspitälern, Hochschulen, dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF), der Swiss Clinical Trial Organisation und weiteren Akteuren des Schweizer Gesundheitssystems aufgebaut.
«Es geht darum, alle an einen Tisch zu holen, um eine sichere Forschungsinfrastruktur für den Austausch von Daten aufzubauen und Standards für deren Aufbereitung zu entwickeln», sagt Urs Frey, Präsident des SPHN Steering Board. Diese Harmonisierung geschieht zurzeit Schritt für Schritt über geförderte Projekte. So wurden an den Universitätsspitälern Data Warehouses aufgebaut, in denen Patientendaten standardisiert und ethisch und rechtlich reguliert erfasst werden. Diese Warehouses sind durch eine ebenfalls neu aufgebaute sichere Netzwerkplattform namens Biomed-IT untereinander und mit den Hochschulen verbunden.
Initiativen laufen aus
Das SPHN hat allerdings ein Ablaufdatum, 2024 wird die Initiative gestoppt. Wie die Dateninfrastruktur künftig weitergeführt und finanziert wird, ist noch offen. Eine weitere Lücke dürfte zudem bald durch das Ende der Finanzierung von Longitudinalstudien entstehen. Bis 2020 hat der SNF rund zehn solche Studien finanziert, die etwa Schweizer Lungen- oder Herzpatienten über Jahrzehnte hinweg begleiteten. «Solche Daten sind extrem wertvoll, weil sie nicht nur eine Momentaufnahme sind, sondern zeigen, wie sich die Gesundheit der Studienteilnehmenden entwickelt», sagt Christoph Meier, Leiter Projekte Lebenswissenschaften beim SNF. Allerdings: Die letzten dieser Studien laufen 2024 aus. Wie eine allfällige neue Finanzierung aussehen könnte, ist noch unklar und wird SNF-intern geprüft.
«Es geht darum, eine sichere Infrastruktur für den Austausch von Daten aufzubauen und Standards für deren Aufbereitung zu entwickeln.»Urs Frey
Indessen wünscht sich die Forschendengemeinde mehr Engagement vonseiten der Gesundheitspolitik. «Um die personalisierte Medizin rasch voranzutreiben, müsste sich das Schweizer Gesundheitssystem stärker als bisher auf Forschung konzentrieren», sagt Jacques Fellay. Laut dem Onkologen Andreas Wicki benötigt es dafür ein anderes Anreizsystem. «Wir bräuchten eine Finanzierung, die jene Anbieter von Gesundheitsleistungen belohnt, die qualitativ gute und austauschbare Forschungsdaten generieren.»
Michael Keller jedenfalls hat durch die personalisierten Therapien eine deutlich bessere Überlebenschance. Vor deren Aufkommen lebten weniger als zehn Prozent der Melanom-Patienten mit Metastasen zehn Jahre nach der Diagnose noch. Heute sind es über die Hälfte.
Horizonte Magazin