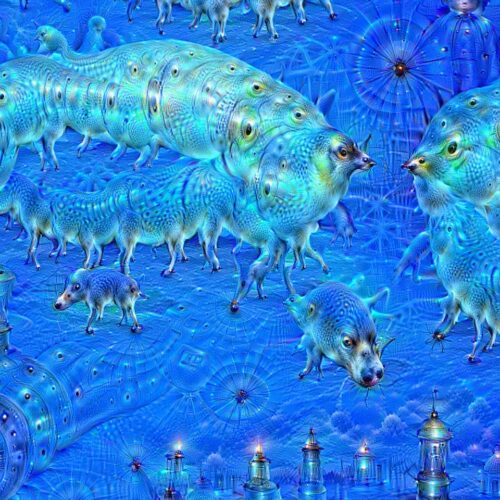Das musst du wissen
- Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, flüchtete die Wissenschaftlerin Tetiana Lapikova-Bryhinska in die Schweiz.
- Nun forscht die Postdoktorandin an der Universität Zürich zu den Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- Möglich gemacht haben dies verschiedene Organisationen, ein Stipendium – und ein bisschen Glück.
Die Welt von Tetiana Lapikova-Bryhinska beginnt in einem Dschungel aus Hochhäusern. Campus Schlieren, gesichtslose Wolkenkratzer, einer sieht aus wie der andere. In der Nummer zwölf befinde sich ihr Forschungslabor, hatte die ukrainische Postdoktorandin zuvor per Mail erklärt. Drei Runden um den Block, dann endlich taucht das blaue Schild der Universität Zürich auf. Die Eingangstür schwingt auf, eine junge Frau tritt ins Freie und zieht den beigen Blazer enger um sich. «Hello, I’m Tetiana!»
Auf der Liftfahrt in den vierten Stock wird schnell klar: Die ukrainische Wissenschaftlerin ist zwar erst wenige Wochen in der Schweiz, fühlt sich an ihrem neuen Arbeitsplatz aber schon wie zu Hause. «My work family» – meine Arbeitsfamilie, wird sie später sagen, wenn sie von ihrem internationalen Forschungsteam spricht, von den modernen Labors der Universität Zürich schwärmt und davon, dass sie ein grosser Fan von ihrem Wohnort Zürich-Hottingen sei – «a fancy district», ein schickes Quartier. Nur, dass die Läden abends noch vor zwanzig Uhr schliessen und auch sonntags nicht geöffnet sind, hat sie anfangs ein wenig irritiert. «Gerade, wenn man nach der Arbeit noch schnell etwas einkaufen will», erklärt sie. Dann vermisst sie ihre pulsierende Heimatstadt Kiew mit den vielen 24-Stunden-Läden besonders. Sie führt in die Küche: «Kaffee, Wasser?» Dass man das Leitungswasser in der Schweiz trinken könne, schätze sie besonders – in der Ukraine sei dies nicht in allen Gegenden möglich.
Die ukrainische Wissenschaftlerin ist zwar erst wenige Wochen in der Schweiz, fühlt sich an ihrem neuen Arbeitsplatz aber schon wie zuhause.
Ein Stipendium für ein Jahr in Zürich
Tetiana Lapikova-Bryhinska erzählt ihre Geschichte in einem Seminarraum mit Blick über Schlieren. Seit rund drei Monaten forscht und arbeitet die Molekularbiologin jetzt in Zürich. Möglich gemacht hat dies ein Stipendium, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) sowie vom internationalen Netzwerk Scholars at Risk. Dass sie ausgerechnet in Zürich landete, ist nicht ganz zufällig: Bereits letzten Herbst war die 35-Jährige, die ihre Doktorarbeit in Kiew am Bogomoletz-Institut für Physiologie (NAS) verteidigte, kurz hier zu Gast. Im Rahmen eines Forschungswettbewerbs gewann sie einen Zuschuss für einen einmonatigen Aufenthalt am Zentrum für Molekulare Kardiologie – ihrem heutigen Arbeitgeber. Als dann Monate später in der Ukraine der Krieg ausbrach, waren es ihre Mitforschenden aus Zürich, die sie kontaktierten und ihr mit Informationen für ein Stipendium als Postdoktorandin aushalfen. Der Rest war schnell geklärt. Über eine Zwischenstation in Deutschland bei ihrem Onkel flüchtete die junge Forscherin mit ihrem 14-jährigen Sohn Danilo Anfang März in die Schweiz. Hier kann sie nun ein Jahr lang arbeiten. Unglaublich dankbar sei sie dafür, sagt die Ukrainerin immer wieder. Hier sei alles so modern, mit den neusten Labor-Instrumenten ausgerüstet und so gut organisiert. «Wenn ich mein Traumlabor beschreiben müsste, es wäre genau dieses hier», schmunzelt sie.
Ihren heutigen Arbeitgeber kennt sie schon von früher. Noch vor dem Ukraine-Krieg gewann sie durch einen Forschungswettbewerb einen Aufenthalt in Zürich.
Bomben, mitten in der Nacht
Hinter der aufgestellten Ukrainerin liegt allerdings eine schwierige Zeit. Wenn sie von den Tagen vor ihrer Flucht in die Schweiz erzählt, wird die Stimme von Tetiana Lapikova-Bryhinska ernst. Als Ende Februar russische Truppen in der Ukraine einmarschieren, erwacht sie manchmal mitten in der Nacht vom Knall explodierender Bomben. Kommen die Kriegstruppen näher? Wurde das Haus getroffen? Wie lange ist sie in Kiew noch sicher? Zehn, zwölf Tage hält sie diese Angst und Ungewissheit aus, dann ist ihr klar: Sie muss hier weg. Die Flucht in die Schweiz tritt sie allein mit ihrem Sohn Danilo an, ihre gesundheitlich angeschlagene Mutter muss sie in der ukrainischen Hauptstadt zurücklassen. «Ich bete jeden Tag für sie», sagt sie und umschliesst das goldene Kreuz, das an einer Kette um ihren Hals hängt. Zum Glück habe ihre Mutter in Kiew Freunde und Nachbarn, die sich gut um sie kümmern und einen Hund, der sie ablenken würde, erzählt sie. Jeden Tag schreiben sich Mutter und Tochter Nachrichten oder telefonieren. «Es geht ihr gut, aber sie muss regelmässig in die Tiefgarage unseres Wohnblocks flüchten, wenn draussen wieder Bomben fallen», erzählt die Wissenschaftlerin. «Keine einfache Situation – ich wünschte, auch meine Mutter wäre in Sicherheit.»
Herz- und andere Zellen unter dem Mikroskop
Nicht ständig an die Situation in der Ukraine zu denken und sich übers Internet über die aktuelle Lage zu informieren, sei oft herausfordernd, sagt Tetiana Lepikova-Bryhinska. Ihre Forschung sei ihr dabei zum Glück eine grosse Hilfe. Im Labor arbeitet sie an einem Projekt, das die Mechanismen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen untersucht – zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall oder Bluthochdruck. Dabei kommen molekulargenetische Forschungsmethoden zum Zug. Unter dem Mikroskop analysiert ihr Team unter anderem menschliches Plasma, Blutproben und Zellkulturen auf Werte, die anzeigen, ob ältere Menschen eine Veranlagung für solche Erkrankungen haben.
Mit molekulargenetischen Methoden erforscht sie Mechanismen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Zur Forschung gehört auch die Suche nach sogenannt langen, nicht-kodierenden RNA, die an Entzündungen oder Krebs beteiligt sein können. Allesamt sehr neue und moderne Ansätze, erzählt die Molekularbiologin stolz. Auch Experimente mit Mäusen sind Teil der Laboruntersuchungen. Momentan hantiert die Ukrainerin in ihrem Alltag aber eher mit verschiedenen Flüssigkeiten und Pipetten, notiert die Ergebnisse säuberlich in ihr Forschungstagebuch oder bringt Proben zurück in den auf Minus achtzig Grad gekühlten Eisschrank. Um diesen zu öffnen und ihre Finger vor Verletzungen zu schützen, schlüpft sie jeweils in dicke Handschuhe. «Do not leave the door open» – «Lassen Sie die Tür nicht offen», steht in roten Lettern am Kühlschrank. Dreimal kontrolliert die Forscherin, ob die Tür auch wirklich eingerastet ist, bevor sie den Kühlraum wieder verlässt.
Gut eingelebt hat sich nicht nur die 35-Jährige – auch ihr Sohn Danilo habe gerade erste Freundschaften geschlossen, erzählt die Frau mit dem wachen Blick stolz. Er besuche seit Kurzem das Realgymnasium Rämibühl in Zürich. Mit dem Schulfach Französisch habe er zwar noch Mühe, denn diese Sprache habe er daheim in Kiew nicht gelernt. Doch sie sei froh, dass er insgesamt mit dem Schulstoff gut klar komme. Ein paar Brocken Schweizerdeutsch habe er bereits aufgeschnappt. «Wer weiss, vielleicht lerne ich das auch noch?», schmunzelt sie. An ihrem Arbeitsplatz mit Forschenden aus aller Welt sei glücklicherweise Englisch die Hauptsprache. Und ihr Betreuer Alexander Akhmedov habe per Zufall ebenfalls ukrainische Wurzeln – auch das habe ihr geholfen, sich zurechtzufinden. «Und es ist praktisch, wenn mir mal ein Fachbegriff nicht einfällt auf englisch – dann frage ich einfach ihn auf ukrainisch.»
«So viele Briefe!»
Gibt es neben den Ladenöffnungszeiten sonst noch Dinge, die sie seltsam findet in der Schweiz, an die sie sich erst noch gewöhnen muss – abgesehen von den Ladenöffnungszeiten? Die Forscherin überlegt kurz, dann muss sie lachen. Etwas falle ihr tatsächlich ein: Die Post, die in ihrem Zürcher Briefkasten eintrudle. «Diese vielen Briefe!», ruft sie über den Tisch und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Zuhause in Kiew habe sie in den letzten zehn Jahren keinen einzigen Brief per Post erhalten – das meiste werde digital zugestellt, per Mail oder via Apps. Doch hier erhalte sie fast alles in Papierform – Post von der Uni, vom Gymnasium ihres Sohnes, von der Stadt. «Ein bisschen altmodisch seid ihr hier schon noch unterwegs, nicht?», sagt sie augenzwinkernd. Dafür gebe es ganz vieles, das sie grossartig finde in der Schweiz, schiebt sie gleich hinterher: Etwa das kulturelle Angebot in der Stadt Zürich – Kunstmuseum, Landesmuseum, das Museum für Gestaltung, all das hat sie schon besucht. Und die Liste von dem, was sie alles noch vorhabe, sei lang.
«Ich glaube an meine Nation, an mein Volk und an die Menschen, die unser Territorium verteidigen. Wir sind ein freies und ein starkes Land – wir lassen uns nicht unterkriegen.»
Tetiana Lapikova-Bryhinska hofft, dass sich die Lage in der Ukraine bis im Sommer so weit beruhigt hat, dass sie ihre Mutter für ein paar Wochen besuchen kann. Von ihren Freunden an der Universität seien viele nicht mehr in Kiew, sondern ebenfalls in umliegende Länder geflüchtet – nach Deutschland, Polen oder Ungarn. Und auch wenn sie grundsätzlich ein optimistischer Mensch sei: Ihr sei bewusst, dass dieser Krieg nicht von heute auf morgen endet. Gleichzeitig zeigt sie sich kämpferisch: «Ich glaube an meine Nation, an mein Volk und an die Menschen, die unser Territorium verteidigen. Wir sind ein freies und ein starkes Land – wir lassen uns nicht unterkriegen.» Sagts und schickt einen entschlossenen Blick über die Dächer von Schlieren. Könnte man ihre Energie in diesem Moment im Labor messen – sie würde bis weit über den Zürcher Universitätscampus nach Kiew reichen.