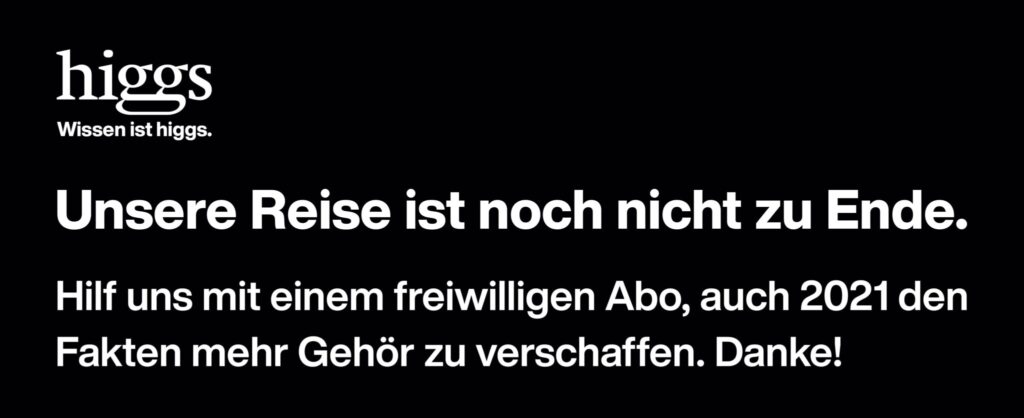Herr Fischer-Tiné, Sie forschen zur Geschichte von Kolonialismus und Imperialismus. Wie waren die Universität und die ETH Zürich an kolonialen Machenschaften beteiligt?
Sie waren stark involviert, wie viele europäische Hochschulen damals. Die Tatsache, dass die Schweiz keine Kolonialmacht war, heisst nicht, dass Schweizer Universitäten nicht mit verschiedenen Aspekten von Kolonialismus in Berührung gekommen wären.


Harald Fischer-Tiné
Wie kam es zu diesen Berührungen?
Zum Beispiel forschten viele Schweizer Ethnologen und Anthropologen in Kolonialterritorien. Auch die damals benutzten Lehr- und Fachbücher waren Teil der paneuropäischen Wissensproduktion, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert stark vom Kolonialismus geprägt war.
Waren Universität und ETH auch direkt in Kolonien tätig?
Ja, es gab die ganzen «Open-air-Sciences» wie Botanik, Zoologie, Ethnologie, Anthropologie, Geologie und Geografie, die viel von kolonialen Konstellationen profitierten. Zahlreiche Akademiker-Karrieren spielten sich in den jeweiligen Kolonien ab. In Papua-Neuguinea konnte man nun mal aufregendere Schmetterlinge finden als im Thurgau. Es war völlig normal, seine Sporen dort zu verdienen.
Also gingen auch Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Kolonien auf «Forschungsreise»?
Die Forscherinnen und Forscher nahmen an solchen Kolonialexpeditionen teil, um ihre Experimente und Messungen durchzuführen – nicht selten mit militärischer Begleitung. Man hatte Zugriff auf Bevölkerungen, die sich nicht wehren konnten, und wenn doch, dann stand der britische Tommy mit dem Gewehr im Anschlag dahinter und sorgte dafür, dass man die betreffende Nase vermessen konnte. Die Kolonialreiche waren wie ein Shoppingparadies für Wissensbestände, die man dort leicht generieren konnte.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde an der Universität Zürich über physische Anthropologie, Rassenhygiene und Eugenik geforscht. Wie kam es dazu?
1899 übernahm Rudolf Martin den Lehrstuhl am anthropologischen Institut der Universität. Da die Disziplin noch relativ jung und nicht unumstritten war, musste er um Anerkennung kämpfen. Martins Argument in seiner Antrittsvorlesung war in etwa: «Unsere Forschung ist wichtig für die Kolonialreiche der Welt, wir können den europäischen Kolonisatoren helfen, ihre Territorien besser zu regieren.» Die Kolonialregimes glaubten also, damit ihre eigenen Untertanen besser verstehen und gruppieren zu können. Und so floss dieses «wissenschaftlich neutrale Wissen» in das Projekt des Kolonialismus ein.
Wie wurde dieses «Wissen» erworben?
Rudolf Martins Nachfolger, Otto Schlaginhaufen, ging in die deutsche Kolonie Papua-Neuguinea und nahm dort spektakuläre Messungen an 800 Melanesiern vor. Von seiner Expedition brachte er auch eine grosse Zahl von Schädeln mit, die in den Laboren und Lehrveranstaltungen an der Universität entsprechend bearbeitet und vermessen wurden. So gelangte das Wissen aus den Kolonien in die Schweiz.
Wurden solche Messungen auch an Menschen in der Schweiz vorgenommen?
Ja, einige Forscher gingen zum Beispiel nach Graubünden, um im Disentis die alpine Bergbevölkerung zu vermessen. Ausserdem holte sich Schlaginhaufen tatsächlich die Erlaubnis vom Militärdepartement ein, um zwischen 1927 und 1932 alle Schweizer Rekruten zu vermessen. In einer Langzeitstudie legte er dann einen quasi-ethnografischen Katalog über die unterschiedlichen rassischen Eigenschaften der Bevölkerung der verschiedenen Kantone an.
Fand solches koloniales Wissen auch in anderen Disziplinen oder Fakultäten Einzug?
Zur Grundausstattung einer deutschsprachigen Universität im 19. und 20. Jahrhundert gehörte auch ein Lehrstuhl für vergleichende indogermanische Sprachwissenschaften. Die Linguisten lernten damals indische Sprachen: klassisches Sanskrit ist ja die Grundlage dieser Disziplin. Und das geht zurück auf koloniale Wissensbestände. Englische Verwaltungsbeamte in Kalkutta erlernten die Sprache zunächst nur, um die Territorien besser kontrollieren zu können, und daraus entwickelte sich – über Umwege – die Indogermanistik. Es trifft also sogar die vermeintlich harmlosen Geisteswissenschaften.
Rudolf Martin und Otto Schlaginhaufen waren beide an der Universität Zürich tätig. Was wissen Sie über damalige prominente ETH-Forscherinnen und -Forscher?
Einer der führenden ETH-Glaziologen, Alfred de Quervain, war 1911 auf einer grossen und medial stark gecoverten Grönlandexpedition. Damals wurde die lokale Inuit-Bevölkerung von Dänemark kontrolliert und christianisiert. Bei den Leitern der Schweizer Expedition zapfte die dänische Kolonialverwaltung das generierte meteorologische und glaziologische Wissen ab und sorgte im Gegenzug dafür, dass die Forscher nicht in Gefahr gerieten – eine Win-win-Situation.
_____________
Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️
_____________
Warum holte man ausgerechnet einen Schweizer?
Den neutralen Schweizer Forscherinnen und Forschern hätte man – anders als etwa Briten oder Russen – nie zugetraut, dass sie den Plan hegten, ein Imperium zu errichten oder Rohstoffe zu rauben. Das öffnete manchen Schweizer Wissenschaftleren Tür und Tor für «Empire Hopping», wie ich es nenne. Auch die Schweizer Gletscherforschung ist also angereichert von diesen kolonialen Kooperationen und dem Wissen der Inuit, das dann bei der nächsten Alpenexpedition in der Schweiz zum Einsatz kam.
Was ist unter «Empire Hopping» zu verstehen?
Manche Karrieren wurden so geschmiedet, dass man zum Beispiel erst mal zwei Jahre in die britischen Kolonialreiche ging, dann war man eine Zeit lang in Niederländisch-Ostindien und würzte das Ganze noch mit einem Abstecher in die französischen Überseegebiete im pazifischen Ozean. Die Schweizer Neutralität machte solche Zirkulationen unproblematisch, hier hatte man einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.
Wie stand es um die Beteiligung der Studierenden bei kolonialistischen Machenschaften?
Das Privileg, an Expeditionen nach Papua-Neuguinea oder Malaysia teilzunehmen war den wenigsten Studierenden vorbehalten. Allerdings kamen im Rahmen von Völkerschauen gelegentlich sogenannte «Exotinnen und Exoten» nach Zürich. Die Zürcher Anthropologen nutzten die Gelegenheit, um diese Menschen schnell zu vermessen. Da ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch Studierende in den Genuss kamen, selber Hand anzulegen.
Aber haben Studierende da einfach brav mitgemacht? Wie sah es mit Gegenbewegungen an den Zürcher Hochschulen aus?
Es gibt auch Spuren dieser Geschichte, und auch diese führen ins Zentrum von Universität und ETH. Hier haben prominente Unabhängigkeitskämpferinnen und -kämpfer ihre Netzwerke geknüpft. Sie fanden auch Sympathien und wurden von der Schweizer Bevölkerung unterstützt.
Wer waren diese Studierenden?
Da gab es zum Beispiel Champakraman Pillai, der ab 1910 Maschinenbau studierte und eine revolutio-näre antikoloniale WG gründete – und zwar mitten im Universitätsviertel an der Bolleystrasse 56. Dort wohnten zwei indische und zwei ägyptische Revolutionäre sowie eine Schweizerin, die als Übersetzerin fungierte. Innerhalb der kolonialen Strukturen gab es also auch antikoloniale Strömungen.
Gab es noch mehr revolutionäre Studierende?
Die Schweiz war kurz vor dem Ersten Weltkrieg ein regelrechtes Sammelbecken, in dem beispielsweise viele russische Studierende in anarchistischen oder sozialistischen Kreisen unterwegs waren. Und dazu gehörten eben auch Studierende, die an verschiedenen Fronten gegen Kolonialismus kämpften.
Warum haben Revolutionäre hier studiert?
Zum einen war es karrierefördernd in Zürich zu studieren, da Hochschulen auch damals schon einen hervorragenden Ruf hatten. Andererseits fanden hier die Revolutionärinnen und Revolutionäre insbesondere zwischen 1911 und 1915 ideale Bedingungen vor.
Und die spazierten einfach unbehelligt in Zürich herum?
In der neutralen Schweiz tummelten sich zwar auch die deutschen, französischen und britischen Geheimdienste. Sie schrieben viele detaillierte Reports darüber, was revolutionäre Gruppierungen den ganzen Tag lang getrieben haben. Aber sie durften nicht zugreifen. Man konnte auch relativ unproblematisch Geld transferieren, um die Bewegungen in den Heimatländern zu unterstützen.
Die koloniale Vergangenheit war also nicht nur dunkel.
Überhaupt nicht. Für eine kurze Zeit waren Zürich, aber auch Genf und Lausanne, sehr bedeutend für den Aufbau transnationaler antiimperialistischer Netzwerke und hatten ihre «five years of fame». Zürich könnte sich vielleicht sogar für kurze Zeit als Hauptstadt des Antiimperialismus bezeichnen, weil hier sehr viele Fäden zusammenliefen.
Es würde sich also lohnen, die Vergangenheit endlich richtig aufzuarbeiten?
Ja, genau. Die koloniale Verstrickung soll auch in die verschiedenen Fakultäten getragen werden. In meinen Vorlesungen sind die Leute jedenfalls oft überrascht bis entgeistert zu erfahren, welche Verstrickungen es gab, weil sie das im Verlauf ihres Fachstudiums nie gehört haben.
Wie soll diese Aufarbeitung aussehen?
Es geht um das Bewusstsein dafür, die Sensibilität für koloniale Verflechtungen und Relikte zu schaffen. Das ist viel subtiler als eine martialische Statue. Von dieser kann man sich ja schnell befreien, und im Zweifelsfall stürzt man sie ins Meer, und dann ist Ruhe. Aber die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit, also eine detaillierte Analyse, wie diese «traces of empire» unsere Wissensbestände und unsere Hochschulen geprägt haben, ist eine viel langwierigere Aufgabe. Es wäre kurz- bis mittelfristig dringlich, darüber zu sprechen und klar zu sagen, was man behalten möchte, wozu man steht und wovon man sich distanzieren will.
Was müssten Universität und ETH Zürich genau unternehmen?
Ich glaube es wäre überfällig, ein grosses Forschungsprojekt zu lancieren. Dann könnten sich sowohl die Universität Zürich als auch die ETH Zürich wirklich Sporen verdienen. Sie könnten dann als eine der ersten Hochschulen in Kontinentaleuropa sagen: «Wir warten nicht auf politischen Druck und Medienrummel, wir erforschen unsere Geschichte selbst und machen die kolonialen Verstrickungen transparent.» Dafür müssten beide Institutionen Geld in die Hand nehmen und dies tatsächlich seriös erforschen lassen.
Aber würde das die Zürcher Hochschulen nicht diskreditieren?
Nein, im Gegenteil. Es wäre meiner Meinung nach ein riesiger Selling Point für das internationale Renommee. Man sollte nicht auf die Vorwürfe von morgen warten: Für eine Universität des 21. Jahrhunderts wäre es ein Gebot der Transparenz, die viele Studierende aus Asien und einige wenige aus Afrika anzieht, diese Dinge zeitnah anzugehen.
Zürcher Studierendenzeitung