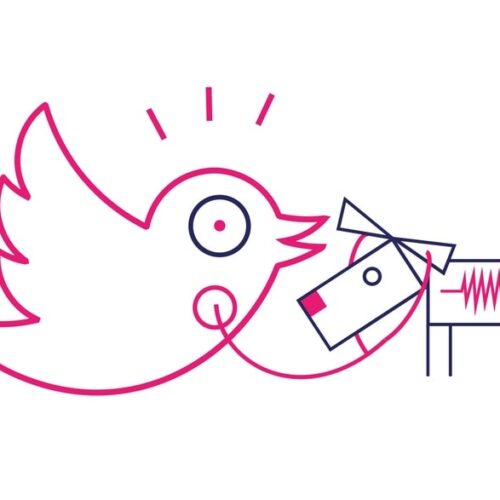«Bislang waren ausführliche Informationen zu den politischen Mitteln, deren Herkunft, Empfängern und Verwendung weitgehend unbekannt. Nur häppchenweise schafften es Medienschaffende oder Forschungsinstitute, da und dort etwas Licht ins Dunkel zu bringen», schreiben die beiden Wirtschaftswissenschafter Peter Buomberger und Daniel Piazza.
Buomberger ist ehemaliger Chefökonom der Bank UBS, Piazza war Finanzchef der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP). Die liberal eingestellten Experten sind also Insider – und betonen, das Buch ohne Auftrag geschrieben zu haben. Ihr Werk heisst «Wer finanziert die Schweizer Politik?» und ist im NZZ Libro Verlag soeben erschienen.
Die Schweiz ist ein Extremfall
Vier Befunde fallen bei der Lektüre auf.
Erstens: Die Schweiz ist in Bezug auf private Spenden in der Politikfinanzierung mit einem Anteil von rund neunzig Prozent in Europa ein Extremfall. Nur Grossbritannien kennt ähnliche Verhältnisse. Nachbar Österreich bildet mit rund achtzig Prozent staatlicher Finanzierung das eigentliche Gegenmodell.
Zweitens: Zwei Drittel der Spenden für die Politik kommen von Privatpersonen – und nicht etwa, wie oft angenommen, von Unternehmen. Ein Drittel kommt von Nicht-Regierungsorganisationen. Zu diesen zählen die Autoren Dach- und Branchenverbände der Wirtschaft, die Gewerkschaften, Komitees bei Abstimmungen und spontane Gruppierungen.
Drittens: Hauptsächliche Nutzniessende der Finanzierung sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Verbände. Auf die Parteien entfällt ein Fünftel.
Viertens: Linke wie rechte NGOs erhalten für ihre politischen Aktionen ähnlich viel Geld.
Stimmen die Zahlen für das Wahljahr 2019, spendete durchschnittlich jede der rund fünf Millionen wahlberechtigten Personen zwanzig Franken für politische Akteurinnen und Akteure. Oder umgekehrt: Die politischen Akteurinnen und Akteure verwendeten einen solchen Betrag, um eine wahlberechtigte Person für sich zu gewinnen.
Die teilweise überraschenden Ergebnisse setzen aber eine Definition voraus, die nicht alle teilen dürften, denn die Autoren haben die Finanzierung der Infrastrukturen von Polit-Akteurinnen und Akteuren ausgeklammert. Wer in einer Organisation nicht direkt an einer entscheidungsrelevanten Stelle arbeitet, wurde nicht in die Untersuchung miteinbezogen.
Kleinspenden verändern das Spiel
Ihre Befunde stellen die Autoren unter eine allgemeinere These. Demnach nahmen Politikspenden in der jüngsten Vergangenheit zu. Und das sei ein Trend, werde also auch in der absehbaren Zukunft so sein.
Bis vor kurzem seien grosse Einzelspenden massgeblich gewesen. Inskünftig dürften jedoch die neuen Möglichkeiten des Crowd-Fundings mit eher kleineren Spenden entscheidend werden. Hier drohen die klassischen Akteurinnen und Akteure den Autoren zufolge, den Anschluss zu verpassen.
Transparenz ja, aber welche?
Die Kommerzialisierung der Politik haben auch die Behörden registriert. 2021 bildete sich nach jahrelangem Streit eine parlamentarische Mehrheit, um wenigstens die Parteifinanzen sichtbarer zu machen: Spenden ab 15 000 Franken an Parteien oder Politiker müssen künftig offengelegt werden.
Damit trug das Parlament dem wiederholt aufgesetzten Druck des Europarats Rechnung, berücksichtigte aber auch angenommene Volksinitiativen in verschiedenen Kantonen. Verhindert wurde so jedoch eine Volksabstimmung über eine national lancierte Transparenzinitiative. Diese wurde zurückgezogen.
Auch Buomberger und Piazza empfehlen dringend mehr Transparenz, wenn auch mit Mass. Dabei orientieren sich die Wirtschaftswissenschafter an einem Konzept, das sie als «funktionale Transparenz» beschreiben.
Es besagt: Einsicht in Geldflüsse ist nur soweit nötig, als dass diese Entscheidungen der Bevölkerung tangieren. Voraussetzung dafür: Eine einzelne Spende müsste für ein Gesamtbudget eine relevante Grösse haben.
Konkret mache es Sinn, Politik-Spenden «über einem gewissen Prozentanteil des Budgets oder Spenden mit einer klaren Forderung transparent zu machen», schreiben sie dazu.
Es gelte das Stimm-, Wahl- und Geldgeheimnis
Dass private Mittel in die Politik einfliessen und Private dort also Einfluss nehmen, halten die Autoren grundsätzlich für unbedenklich, gar für positiv. Für sie sind Spenden eine dritte Möglichkeit, wie die Zivilgesellschaft und ihre Akteurinnen und Akteure ihre Präferenzen in der Demokratie ausdrücken kann. Denn zu den Eigenheiten des Schweizer Politsystems zählen sie nicht nur das Wählen und das Abstimmen – sondern eben auch das Finanzieren.
Das kommt im Buch am besten dort zum Ausdruck, wo die Autoren künftige Anforderungen an die Politikfinanzierung aufstellen. Aus ihrer Sicht gilt es beispielsweise, die Privatsphäre der Spendenden gesetzlich zu schützen – analog dem in der Schweiz geltenden Stimm- und Wahlgeheimnis. Sämtliche Politakteure müssten sich auch an die gleichen Transparenzregeln halten. Staatliche Zuschüsse lehnen die beiden Ökonomen rundweg ab.
Das Manko der klassischen Akteure
Die Stärke des Buchs liegt der Präsentation des Zahlenmaterials, das bisher gut gehütet wurde. Verglichen mit bisher publizierten Schätzungen aus Wissenschaft und Medien, ist das ein Meilenstein.
Allerdings bleibt die Datenbasis mit nur einem beobachteten Abstimmungsjahr dünn. Denn gerade bei Abstimmungen hängt vieles vom jeweiligen Thema ab. Aussen- und wirtschaftspolitische Vorlagen führen zu kommerzialisierten Kampagnen. Exotenthemen mit hohem Symbolwert lassen sich auch ohne gut kommunizieren. Im beobachteten Jahr entwickelte zum Beispiel die Konzernverantwortungs-Initiative einen grossen Sog, der viele Kleinspenden anzog.
Tatsächlich neu ist, dass online neue Räume für die Kommerzialisierung der Politik entstehen. Die tatsächlichen Auswirkungen davon wird man wohl erst in einigen Jahren kennen.
Buomberger und Piazza knüpfen jedoch schon jetzt ihre grösste Sorge daran. Sie vermuten, dass traditionelle Akteure wie etwa Parteien den Anschluss verpassen und von zivilgesellschaftlichen Kräften überholt werden könnten.
Am Ende – so die Befürchtung der Autoren – könnten Parteien gar gezwungen sein, mehr staatliche Finanzierung einzufordern. In den Augen der beiden liberalen Autoren wäre dies ein klassischer Sündenfall.