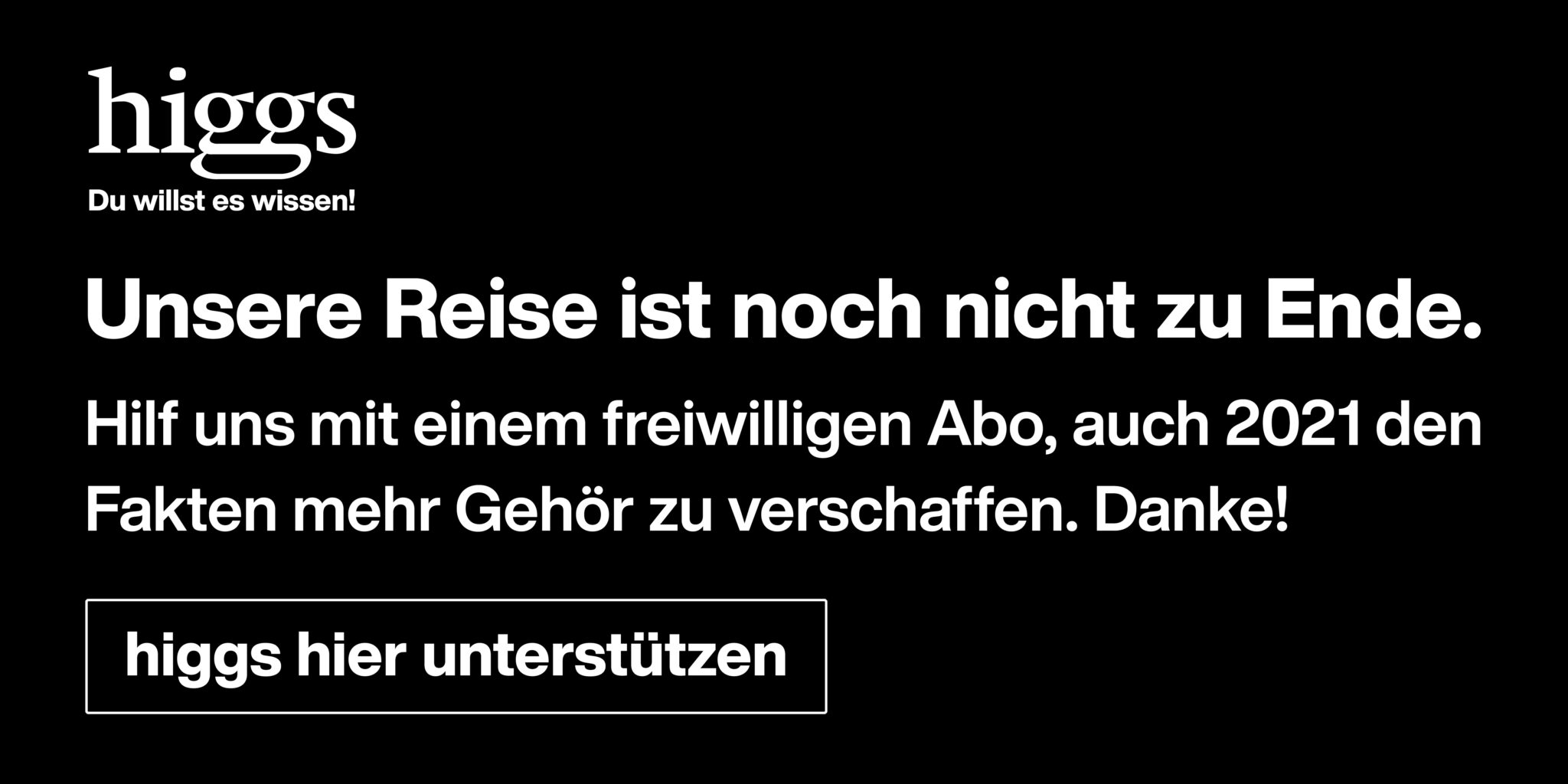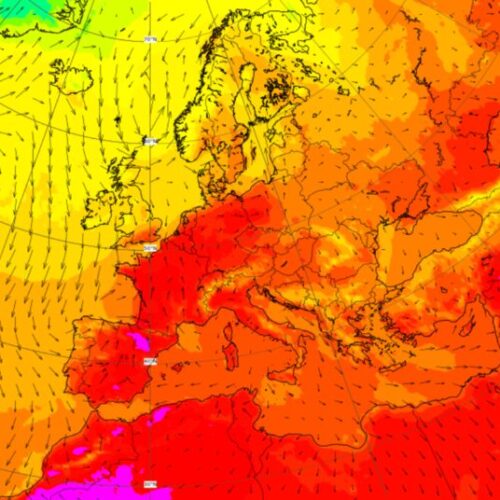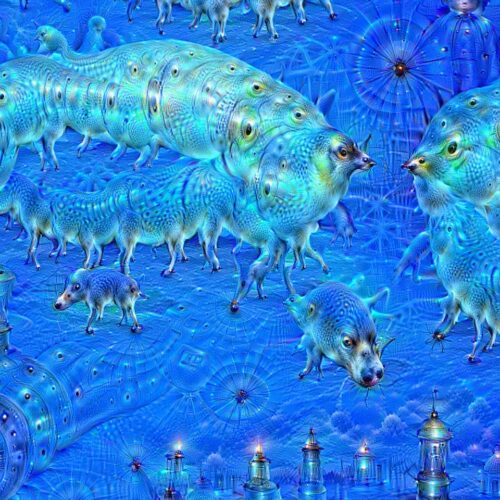Das musst du wissen
- Die Evolutionsmedizin beschäftigt sich mit der Frage, wieso wir unter bestimmten Krankheiten leiden.
- Sie sieht das Gleichgewicht zwischen krank und gesund sein als ein Ergebnis der Evolution.
- Das Verständnis dieser Zusammenhänge soll auch genutzt werden, um die Krankheiten zu behandeln.
Herr Thomas, man hat den Eindruck, dass das Zusammenspiel zwischen Medizin und Evolutionswissenschaft nicht so einfach und selbstverständlich ist, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte. Teilen Sie diese Ansicht?
Ja, und dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass Ärzte jedes Mal, wenn ein Adjektiv zu «Medizin» hinzugefügt wird, eine Art viszeralen (die Eingeweide betreffenden, Anm. d. Red.) Ablehnungsreflex haben. Denn es gibt eine Menge Scharlatane die mit Eukalyptuszäpfchen oder ähnlichem Unsinn aufwarten. Daher neigen die Ärzte dazu, zu glauben, dass es nur eine einzige Medizin gibt: ihre eigene. Und sobald man ein Adjektiv verwendet, sind sie sehr vorsichtig. Anstatt den Begriff Evolutionsmedizin zu verwenden, bevorzuge ich die Begriffe Gesundheit, Medizin und Evolutionswissenschaft.
Der zweite Grund, warum das Zusammenspiel nicht völlig harmonisch ist, liegt darin, dass eine wissenschaftliche Abschottung stattgefunden hat und nur wenige Menschen den Willen haben, diese zu durchbrechen. Jeder weiss heute, dass die verschiedenen Disziplinen miteinander reden müssen. Die Entwicklung zeigt allerdings nicht wirklich in diese Richtung, denn die Wissenschaft wird immer komplexer und spezialisierter. Man müsste eine Kohorte von jungen Forschenden mit dieser doppelten Kultur aufbauen: Medizin und Evolutionsbiologie. Dies ist das Ziel des Universitätsdiploms in evolutionärer Medizin in Lyon.
Zudem gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Die klassische medizinische Forschung interessiert sich vor allem für die Mechanismen, die der Gesundheit und ihren Störungen zugrunde liegen, während die Evolutionsmedizin zu ergründen sucht, warum die Evolution diese pathologischen Mechanismen geformt hat. Dem Patienten ist dies meist egal. Ein alter Mann, der seinen Arzt aufsucht, weil er Rückenschmerzen oder Erektionsstörungen hat, will nicht wissen, was Seneszenz oder antagonistische Pleiotropie (Erklärungsmodell für das Altern von Organismen, Anm. d. Red.) ist. Was er will, sind ein paar Pillen, damit er nach Hause gehen kann und alles in Ordnung ist.


Frédéric Thomas
Die Evolutionsmedizin erklärt viele Pathologien durch die Diskrepanz zwischen evolutionär geprägten Verhaltensweisen und einer sich rasch verändernden Umwelt. Ein Beispiel?
Wenn wir Zucker essen, empfinden wir das als angenehm. Dies hatte die Evolution für eine Welt mit spärlich vorhandener Energie selektioniert. Aber heute ist es eine darwinistische Falle, und wenn wir bei jeder Gelegenheit Zucker essen, werden wir gesundheitliche Probleme bekommen. Die Evolutionsmedizin kann sehr bestimmt sagen, was man nicht tun sollte, um gesund zu bleiben.
Das heisst aber nicht, dass wir immer der alten Lebensweise folgen sollten. Rohköstler gehen davon aus, dass wir früher roh gegessen haben und zu dieser Art der Ernährung zurückkehren sollten, doch sie kriegen viele gesundheitliche Probleme. Es ist mehr als 250 000 Jahre her, dass wir das Feuer domestiziert haben, die Länge unseres Darms hat sich dadurch verringert und sich jetzt eindeutig an gekochtes Essen adaptiert. Wir sind an die Bedingungen von gestern, aber nicht mehr an die von vorgestern angepasst.
Unter diesem Gesichtspunkt geben die Evolutionswissenschaften Aufschluss über das «Warum» bestimmter Pathologien. Aber das ist nicht alles, was zählt. Infektionskrankheiten und Krebs sind eindeutig Bereiche, in denen die Evolutionswissenschaft nicht nur die Entstehung beleuchten, sondern auch zu neuen Therapien oder Behandlungsstrategien führen kann.
Sie sind ein Evolutionsbiologe. Wie sind Sie dazu gekommen, eine Brücke zwischen Evolutionswissenschaft und Medizin zu schlagen?
Ich habe mich mit Parasiten und Verhaltensmanipulationen beschäftigt. Zum Beispiel mit dem kleinen Egelwurm, der Ameisen veranlasst, an Grashalmen hochzuklettern, um von Schafen gefressen zu werden. Aber wenn man älter wird, denkt man, dass man der Gesellschaft nützlich sein muss. Und ich habe meine Mutter an Krebs sterben sehen. Angesichts eines solchen biologischen Prozesses, hatte ich ein unerträgliches Gefühl der Ohnmacht. Ich ging nach San Francisco, um etwas über Krebs zu lernen. Zunächst hatte ich ein wenig Angst davor, mich mit «DER Krankheit» zu befassen, auch weil die forschenden Ärzte oft ein grosses Ego haben, aber tatsächlich ist die evolutionsbiologische Sichtweise in diesem Bereich sehr gut akzeptiert. Die Evolutionswissenschaft in den Gesundheitsbereich einzubringen, ist sowohl eine intellektuelle als auch eine humanitäre Herausforderung.
Nehmen wir das Thema Krebs, das zu Ihrem Hauptthema geworden ist. Wie kann man das im Zusammenhang mit der Evolution erklären?
Wir sind in der Lage, uns selbst zu reproduzieren, indem wir uns vermehren, aber wir selbst bestehen aus sich reproduzierenden Einheiten: unseren Zellen. Normalerweise kooperieren diese Einheiten miteinander, um das ordnungsgemässe Funktionieren des Organismus zu gewährleisten, und die klassischen Zellen reproduzieren sich nicht. Aber manchmal «schummeln» sie und vermehren sich. Dies kommt in der Welt des Lebendigen ständig vor. Deshalb hat sich unser Körper so entwickelt, dass er diese Zellen erkennt und zerstört, und zwar durch unsere Immunabwehr und andere Mechanismen wie die Apoptose (programmierter Zelltod, Anm. d. Red.). Wenn diese Abwehrkräfte versagen, entwickelt sich ein Tumor, und wir sprechen von Krebs.
Wie kann diese Sichtweise zu neuen Behandlungsstrategien führen?
Wenn man einen Krebs hat, der noch lokalisiert und operabel ist, ist klar, dass man operieren muss, den Tumor entfernen, und das Problem ist gelöst. Aber invasive Krebserkrankungen, die sich bereits im ganzen Körper ausgebreitet haben, kommen oft noch einem Todesurteil gleich. Jede einzelne Krebszelle abtöten zu wollen, führt oft in eine Sackgasse. Das Gleiche gilt für Pestizide oder Antibiotika: Der wahllose Einsatz von Pestiziden und Antibiotika führt häufig zur Selektion von Resistenzen. Kurzfristig funktioniert das, aber langfristig ist es kontraproduktiv.
Wie kann dies vermieden werden?
Mit einer adaptiven Therapie. Da Krebs vor allem ein evolutionärer Prozess der Körperzellen ist, können wir eine Strategie entwickeln, die sich ständig weiterentwickelt, um dem Feind einen Schritt voraus zu sein, indem wir seine Reaktionen vorhersehen. Anstatt zu sagen, dass nur eine tote Krebszelle eine gute Zelle ist, gehen wir davon aus, dass es Krebszellen gibt, die es wert sind, behalten zu werden, weil sie nicht sehr gefährlich sind (weil sie auf die Behandlung reagieren, Anm. d. Red.). Sie konkurrieren dann mit den behandlungsresistenten Zellen, die sich oft weniger schnell vermehren, und ermöglichen es, sie durch Monopolisierung der Ressourcen unter Kontrolle zu halten.
Wird diese Strategie bereits beim Menschen angewandt?
Professor Gatenby vom Moffitt Cancer Center in Florida, einem der fortschrittlichsten Krebszentren der Welt, hat diese Strategie erfolgreich an Mäusen getestet. Heute behandelt er Patienten mit resistentem metastasierendem Prostatakrebs (im Allgemeinen unheilbar, Anm. d. Red.), mit sehr interessanten Ergebnissen in Bezug auf das Überleben. Und da es sich um eine leichtere Dosis der Chemotherapie handelt, ist sie für die Patienten viel leichter zu ertragen. Zudem gibt es einen Paradigmenwechsel: Es geht nicht mehr darum, den Krebs auszurotten, das ist nicht mehr möglich, sondern ihn unter Kontrolle zu behalten. Und das ist nicht immer leicht zu akzeptieren, da wir seit Jahren vom «Krieg gegen den Krebs» sprechen.
Ein weiteres Beispiel für eine evolutionäre Strategie?
Ja, und zwar ist dieses vom Prozess des Artensterbens inspiriert. Es ist selten, dass ein Ereignis alle auf einmal tötet. In der Regel gibt es zunächst ein grösseres Ereignis, das die Grösse und genetische Vielfalt der Population verringert, und danach viele kleine Zufallsprozesse, die die Arbeit beenden. Bei den Dinosauriern war es zunächst ein Meteorit, dann Nahrungsmangel oder Parasiten usw. Übertragen auf Krebs bedeutet dies, dass wir einen grossen Tumor mit einer Chemotherapie verringern und zerkleinern können. Aber man muss sie – selbst wenn sie funktioniert – im richtigen Moment stoppen, was wir im Moment nicht tun, um den Krebs mit einer Vielzahl anderer kleiner Therapien anzugreifen.
Sie haben auch den Beitrag der Evolutionswissenschaften zu Infektionskrankheiten erwähnt. Können Sie das in zwei Sätzen beschreiben?
Einer der wichtigsten Punkte ist die Entwicklung von Strategien zur Vermeidung der Selektion von Resistenzen, zum Beispiel in der Bevölkerung eines Landes oder in einem Krankenhaus. Heute arbeiten Forscher an der Idee, Antibiotika zu wechseln, um die Selektion resistenter Keime zu vermeiden. Es gibt auch die ganze «One Health»-Forschung, die zeigt, in welchem Masse die Störung von Ökosystemen die Übertragung von Krankheitserregern von Tieren auf den Menschen fördern kann. Wir haben ein Beispiel dafür mit Covid. Es ist wirklich notwendig, über unsere Beziehung zur Natur und die Auswirkungen unserer Aktivitäten auf unsere Umwelt nachzudenken, sonst wird es wie ein Bumerang zurückkommen.
Es gibt hier eine Konstante, nämlich dass die langfristigen Auswirkungen ohne einen evolutionären Fokus schwer fassbar sind.
Ja, es gibt ein klassisches Beispiel: Um die Fischbestände zu schützen, sagen wir, brauche es grossmaschige Netze, damit die kleinen Fische durchschlüpfen und sich vermehren können. Dies ist in dem betreffenden Moment sinnvoll, kann aber im Laufe der Zeit zu einer früheren Geschlechtsreife und damit zu einem Selektionsdruck führen, der nicht unbedingt gut für die Zukunft der Population ist. Das kann beispielsweise passieren, wenn kleinere Fische weniger oder kleinere Eier legen oder eine schlechtere Qualität der elterlichen Betreuung bieten.
Eine Massnahme, die zu einem bestimmten Zeitpunkt nützlich ist, kann sich auf lange Sicht als schädlich erweisen, wenn man sie aus der evolutionären Perspektive betrachtet. Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn ausser im Licht der Evolution. In der Medizin ist es genau dasselbe: Wenn man einen Tumor behandelt und ihn mit einer Chemotherapie um neunzig Prozent verkleinert, geht es der Person tatsächlich besser. Wenn man jedoch Resistenzen selektioniert, laufen wir Gefahr, das Gegenteil des gewünschten Ergebnisses zu erreichen. Wir müssen die evolutionären Kaskaden in alle unsere Entscheidungen einbeziehen.
Heidi.news