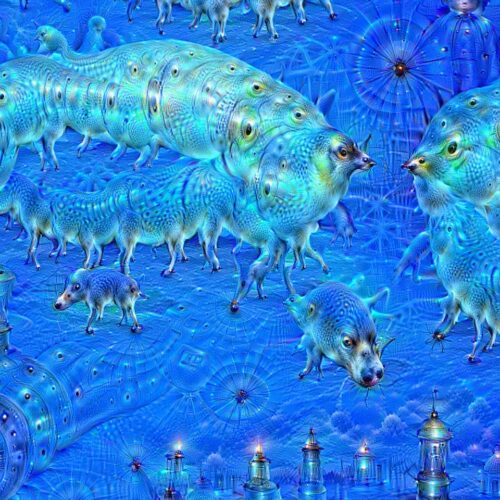Das musst du wissen
- Nur von etwa 80% aller klinischen Versuche in der Schweiz sind Resultate zu finden. Der Rest landet in der Schublade.
- Ein Hauptgrund dafür ist, dass negative Ergebnisse von Versuchen kaum in Fachmagazinen publiziert werden können.
- Aber auch Misserfolge sind wertvoll. Sie müssten in Registern erfasst werden, damit sie anderen zur Verfügung stehen.
«Unterschlagenes Wissen schadet», titelte die Sendung «Puls» im Schweizer Fernsehen SRF diese Woche. Die Recherche des Magazins hatte ergeben, dass jede fünfte klinische Studie, die an Schweizer Universitätsspitälern durchgeführt wird, unveröffentlicht in der Schublade landet. Warum schaffen es Forschungsergebnisse – und damit wertvolles Wissen über Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten und Therapien – nicht auf die Bildfläche der Medizin?
Rund 20 Prozent der Schweizer Studien werden nicht veröffentlicht – zum Nachteil von Forschung, Medizin und Betroffenen. @srfdata https://t.co/Uj3PFjUpxW
— SRF News (@srfnews) February 11, 2019
Ein Hauptgrund liegt in einem der grössten Probleme des gesamten Wissenschaftssystems: Der Scheu vor negativen Ergebnissen. Sobald ein Medikament keine Wirkung zeigt, ein Versuch nicht klappt oder eine Entwicklung scheitert, sinkt das Interesse der Wissenschaftler am Projekt rapide. «Alle haben lieber positive Resultate», sagt Martin Schwab, Hirnforscher an der ETH und Universität Zürich. «Denn auf positive Resultate kann man aufbauen, auf negative nicht.» So wenden sich die Forschenden lieber dem nächsten vielversprechenden Projekt zu. Die Herausgeber und Gutachter von Fachzeitschriften wollen wissen, warum genau etwas nicht funktioniert hat, bevor sie es überhaupt für die Publikation in Betracht ziehen. Doch zur Klärung dieser Frage müssten Forschungsförderer und Industriepartner weiteres Geld einschiessen. Wollen sie das bei einem Projekt, das negativ zu enden scheint? Viel lieber investieren sie in erfolgsversprechendere Projekte. Neurologe Schwab forscht seit 1985 an einer Therapie für Querschnittgelähmte und veröffentlichte zahlreiche Publikationen dazu. Immerhin hat sein Projekt, bei dem ein Antikörper zur Behandlung von Querschnittgelähmten entwickelt werden soll, trotz vielen Rückschlägen die Unterstützung noch nicht verloren: Soeben hat ein klinischer Versuch mit 160 Patienten in ganz Europa begonnen.
Das Problem, dass negative Forschungsergebnisse nicht publiziert werden, ist der Wissenschaft längst bekannt und hat einen Namen: Publication Bias, zu Deutsch etwa Publikationsverzerrung. Und die Wissenschaft wäre nicht die Wissenschaft, wenn sie den Effekt nicht auch wissenschaftlich untersucht hätte und ihn präzise beziffern könnte. Jeden Tag werden weltweit 5000 Studien publiziert. Die meisten davon sind Erfolgsmeldungen – und die Flut dieser Erfolgsmeldungen wird immer mächtiger. So waren im Jahr 1990 knapp 70 Prozent aller wissenschaftlichen Publikationen Berichte über positive Ergebnisse. Im Jahr 2007 waren es bereits über 85 Prozent. Dies nicht, weil die Forschung immer besser würde, sondern weil immer weniger Negatives den Weg in die Fachzeitschriften schafft.
Nur Erfolgsstorys erwünscht
Einige der Publikationsorgane versuchen zwar, ihren Teil zur Lösung des Problems beizutragen. So gibt es mehrere Zeitschriften, die negative Resultate explizit erlauben, oder die sich sogar exklusiv den wissenschaftlichen Misserfolgen widmen. So gründete zum Beispiel der renommierte Springer-Verlag im Jahr 2002 das «Journal of Negative Results in Biomedicine». Doch in den siebzehn Jahren seit seinem Start verzeichnete das Magazin lediglich 250 Beiträge. Vor zwei Jahren stampfte Springer das Magazin wieder ein. Und die Online-Fachzeitschrift «Plos One» verzeichnet in seiner 2015 gestarteten Sammlung «Missing Pieces» – also «fehlende Teile» – gerade mal 36 Publikationen mit negativen Ergebnissen. Im selben Zeitraum veröffentlichte das Magazin über hunderttausend Papers mit positiven Resultaten. Und auch die 2016 an der Uni Zürich gestartete Publikationsplattform «Science Matters», welche ausdrücklich für Unausgegorenes, Halbfertiges oder eben auch negative Resultate zur Verfügung steht, dümpelt mit durchschnittlich etwa einem halben Dutzend Beiträgen pro Monat dahin. In vielen Monaten ist die Zahl der Publikationen gleich Null.
«Wissenschaftliche Zeitschriften werden das Problem des Publication Bias nicht lösen können», sagt Christiane Pauli-Magnus, Leiterin des Departements für klinische Forschung des Universitätsspitals Basel und Präsidentin der Swiss Clinical Trial Organization SCTO. Im Wissenschaftsbetrieb herrsche eine klare Kultur vor: «Für die Forschenden ist die Publikation in einem Journal of Negative Results ein Eingeständnis des eigenen Versagens», sagt sie.
Gefahr für Patienten
Wenn es nur um Laborversuche geht, hält sich der Schaden durch den Publication Bias in Grenzen. Im schlimmsten Fall verzerren die fehlenden Ergebnisse aber die Datenlage für andere Forschungsgruppen und führen vielleicht zu unnötigen Wiederholungen von Versuchen. Doch sobald es um klinische Studien geht, kann der Publication Bias sogar das Leben von Patienten gefährden. So wie im Fall des von Pfizer entwickelten Antidepressivums «Edronax». Der Wirkstoff Reboxetin wurde im Jahr 2000 von den Zulassungsbehörden in fast ganz Europa zugelassen. In der Schweiz wurde das Medikament 2001 kassenpflichtig. Basis für die Zulassung waren klinische Studien, die von Pfizer finanziert waren und die Wirksamkeit des Medikamentes an 1600 Patienten belegten. Doch das war nicht die ganze Wahrheit. Im Jahr 2010 wertete das unabhängige deutsche Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG die Daten von 3000 weiteren Patienten aus, die Pfizer nicht veröffentlicht hatte. Das ernüchternde Ergebnis der neuen Analyse: Edronax ist nicht wirksamer als ein Placebo. Dafür hat es beträchtliche Nebenwirkungen. Zwar belegte eine dritte Auswertung im Folgejahr eine Wirksamkeit bei einer eingeschränkten Patientengruppe – jene mit schweren Depressionen. Doch der Fall zeigte, dass Patienten durch den Publication Bias Schaden erleiden können.
Musterschüler Pharma und Biotech
«Um zu überprüfen, ob Daten aus klinischen Versuchen veröffentlicht werden, müssen wir zuerst wissen, welche Studien überhaupt laufen», sagt Pauli-Magnus. Dazu müssten die Versuche bei Beginn in speziellen Registern erfasst und anschliessend nachverfolgt werden. Um die Forschenden dabei zu unterstützen, finanziert das Universitätsspital Basel seit Anfang 2018 zwei Mitarbeitende am Departement für klinische Forschung. Diese unterstützen die Forschenden des Spitals bei der Planung, Registrierung und späteren Publikation der Versuche. Die Massnahme zeigte Wirkung: Die Registrierungsrate des Unispitals Basel hat sich seither verdoppelt. «Das hat uns selbst erstaunt», sagt Pauli-Magnus. Ihre Motivation ist klar: «Wir spüren eine Verantwortung unseren Patienten gegenüber und wollen ihnen die bestmögliche Behandlung ermöglichen», sagt die Ärztin. «Dafür sind negative Daten genauso wertvoll wie positive.»
Auch für Nicolas Gerber, Leiter Therapiestudien in der Krebsforschung des Kinderspitals Zürich, ist die Publikation der Daten eine Selbstverständlichkeit. «Gerade in der Kinderonkologie haben wir kein Interesse, negative Resultate geheim zu halten. Denn wir wollen nicht, dass Kinder mit wirkungslosen oder sogar schädlichen Medikamenten behandelt werden.»
In der Schweiz ist die Erfassung von klinischen Versuchen seit mehreren Jahren durch das Humanforschungsgesetz HFG vorgeschrieben. Die Europäische Union EU geht bereits einen Schritt weiter. Sie hat im Jahr 2016 ein Gesetz verabschiedet, das alle Forscher dazu verpflichtet, die Ergebnisse klinischer Versuche nach Abschluss innert Jahresfrist in ein Register einzutragen. Alle grossen Pharmafirmen halten sich daran: Roche hat die Resultate von 88 Prozent aller Projekte innert der vorgeschriebenen Frist veröffentlicht, Novartis von 96 Prozent. Bayer, Sanofi Pasteur MFD und CSL Behring schaffen sogar 100 Prozent. Weit abgeschlagen hingegen liegen die Universitäten und Universitätsspitäler. Die meisten haben ihre Ergebnisse in dieser EU-Datenbank gar nicht eingetragen.
Wie können Forschende dazu gebracht werden, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu publizieren? Die Präsidentin der Swiss Clinical Trial Organisation Pauli-Magnus sieht die Verantwortung auch bei den Geldgebern. «Der Schweizerische Nationalfonds SNF und grosse Stiftungen könnten bei der Vergabe von Forschungsgeldern mitberücksichtigen, ob Forschende die Ergebnisse ihrer früheren Versuche publiziert oder in ein Register eingetragen haben». Bestrafungen funktionieren hingegen schlecht, sagt Pauli-Magnus. «Die Forschenden müssen einen Vorteil haben, wenn sie all ihre Ergebnisse veröffentlichen.»