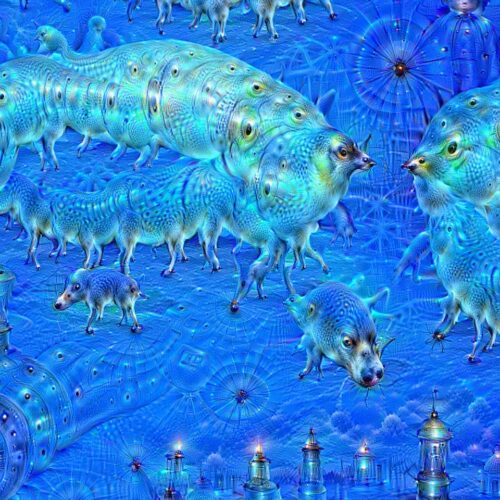«Bei einer weiteren Untersuchung sollte mir ein Kontrastmittel gespritzt werden. Ich hatte davor ziemlich grosse Angst, weil ich wusste, dass mein Körper sehr stark auf so was reagieren würde. Die Krankenschwester schloss mich an den Tropf an, durch den das Kontrastmittel in meinen Körper laufen sollte. Sie sagte mir, dass mir von dem Kontrastmittel heiss werden würde und es auch etwas brennen könnte. Dann liess sie mich allein. Kaum war sie draussen, bemerkte ich, wie mir unheimlich heiss wurde, es durchströmte meinen Körper und es brannte. Ich hatte grosse Angst. Nach ein paar Minuten kam der Arzt herein und meinte: ‹So, nun wollen wir mal das Kontrastmittel spritzen.›»
_____________
Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️
_____________
Diese Schilderung einer Patientin zeigt, wie stark sich eine bestimmte Erwartung auf den Körper auswirken kann. Der Erlebnisbericht, den die Neurowissenschaftlerin Ulrike Bingel und der Psychologe Manfred Schedlowski in ihrem kürzlich erschienen Buch «Placebo 2.0: Die Macht der Erwartung» beschreiben, ist allerdings kein Beispiel für einen Placeboeffekt, sondern für dessen «bösen Zwilling», den sogenannten «Noceboeffekt». Darunter versteht man eine Verschlechterung von unangenehmen Symptomen oder Nebenwirkungen, die aus einer rein pharmakologischen Sicht keinen Sinn ergibt. Nocebos können zum Beispiel Schmerzen verstärken, die Atmung verschlechtern, Allergien auslösen, Übelkeit und Ängste hervorrufen oder sogar den Cortisolspiegel erhöhen. Dabei spielen psychische Komponenten wie frühere Erfahrungen oder die Kommunikation mit dem Arzt und andere äussere Umstände eine entscheidende Rolle.
Weil die Erforschung des Noceboeffekts, also absichtlich herbeigeführten Verschlimmerungen, ethisch kaum vertretbar ist, ist er noch nicht so gut erforscht wie sein positives Gegenstück, der Placeboeffekt. Dieser gilt bei vielen Erkrankungen als nachgewiesen und zumindest teilweise verstanden. Zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Helga Kessler haben die beiden Placeboforscher Ulrike Bingel und Manfred Schedlowski nun in einem Buch zusammengetragen, was die Wissenschaft bisher weiss über diesen faszinierenden Effekt, bei dem der Körper positiv auf ein Medikament reagiert, obwohl dieses gar keinen Wirkstoff enthält.
Schmerzen lindern mit Kochsalz
Bereits vor 250 Jahren wurde der Begriff Placebo, lateinisch für «ich werde gefallen», erstmals in einem medizinischen Kontext verwendet. Als der schottische Mediziner William Cullen 1772 einem Patienten eine Dosis Senfpulver verschrieb, notierte er, dass er seinem Patienten etwas habe mitgeben müssen, sich aber nicht viel davon erwarte. Deshalb nannte er es «Placebo».
Die wissenschaftliche Erforschung des Effekts begann indes erst viele Jahrzehnte später – aufgrund einer Notlüge im Zweiten Weltkrieg: Als im Lazarett des Militärarztes Henry K. Beecher das Morphin ausging, spritzte eine Krankenschwester dem schwer verwundeten Soldaten statt des Schmerzmittels kurzerhand eine Kochsalzlösung. Die Behandlung wirkte und Chirurg Beecher konnte den Soldaten operieren, ohne Anästhesie und ohne dass sein Patient sich über starke Schmerzen beklagt oder einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hätte. Da Engpässe beim Morphium in Beechers Feldlazarett keine Seltenheit waren, kam die Notlüge der Krankenschwester noch einige Male zum Einsatz, bevor der US-Amerikaner nach dem Krieg in die Harvard Medical School zurückkehrte und sich der Erforschung des Phänomens widmete, das ihn so faszinierte.
«Scheinbehandlungen lösen im Gehirn Prozesse aus, die zur Ausschüttung von körpereigenen Hormonen und anderen Botenstoffen führen»
Im Jahr 1955 veröffentlichte Beecher in dem viel beachteten Aufsatz «The Powerful Placebo» die Resultate seiner Studien an über 1000 Patienten. Darin schätzte er, dass rund ein Drittel der Patienten auf Placebos, also eine Scheinmedikation oder Scheinbehandlung, reagieren würden. Damit veränderte sich das medizinische Denken grundlegend. Denn davor musste ein Medikament einfach wirken, seit Beechers Beitrag muss es besser wirken als ein Placebo.
Aber wie ist es überhaupt möglich, dass Placebos Krankheitssymptome lindern, obwohl sie keinen Wirkstoff enthalten? Verantwortlich für die Verbesserung von Symptomen sind sicher mehrere Faktoren: Unter anderem auch die Tatsache, dass viele Krankheiten sowieso mit der Zeit auf natürliche Weise heilen. Daneben gibt es aber auch den eigentlichen Placeboeffekt, der mit neuropsychologischen Phänomenen zusammenhängt, die die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. So weiss man heute, dass Scheinbehandlungen im Gehirn Prozesse auslösen, die zur Ausschüttung von körpereigenen Hormonen und anderen Botenstoffen führen, die an dieselben Rezeptoren binden wie die normalen Medikamente.
Erwartung als treibende Kraft
Im Grunde ist es auch nicht das Placebo, das wirkt, sondern die eigene Erwartung an die Therapie oder die Tablette. Dabei nimmt auch die Art und Weise, wie ein Arzt oder eine Ärztin mit dem Patienten umgeht, einen Einfluss auf diese Erwartungshaltung. Theoretisch können alle Menschen Placeboeffekte erleben, dennoch reagieren nicht alle Menschen gleich auf Placebos: Einige zeigen eine sehr starke Reaktion, einige gar keine und wiederum andere nur eine schwache. Allerdings verstärkt sich der Effekt, wenn man die Behandlung spürt – etwa, indem man beim Legen der Infusion zuschaut oder die Tablette auf der Zunge auch wirklich nach Medizin schmeckt.
Placebo bedeutet aber nicht nur Scheinmedikation mit Pülverchen und anderen Substanzen, auch Akupunktur oder sogar Operationen, die nur zum Schein durchgeführt werden, können Placeboeffekte entfalten. Eindrücklich ist das Ergebnis einer finnischen Studie mit 146 Patienten mit Meniskusrissen, bei denen das beschädigte Meniskusgewebe operativ entfernt wurde. Eine Hälfte der Patienten erhielt die richtige Operation, die andere wurde nur zum Schein operiert, während Nachbehandlung und Pflege nach der OP für beide Gruppen gleich blieb. Der Vergleich zwischen den normal und den «placebo-operierten» Personen Monate später erbrachte eine merkwürdige Erkenntnis: Die Scheinbehandlung hatte genau gleich gut geholfen wie die Operation. Der Zustand beider Gruppen hatte sich bezüglich Lebensqualität und Schmerzen deutlich verbessert. Beide gaben an, mit dem Eingriff mehrheitlich zufrieden zu sein und ihn bei Bedarf gar zu wiederholen. Das soll nicht heissen, dass deswegen nun alle operativen Eingriffe überflüssig wären. Natürlich nicht. Trotzdem verdeutlichen solche Studien, wie stark eine an eine Behandlung geknüpfte positive Erwartung oder eben ein Placeboeffekt sein kann.
Placebo und Sport
Zudem beschränkt sich der Effekt nicht nur auf die Medizin, Placebos wirken sich auch auf die sportliche Leistung aus. So verbesserte ein vermeintlich koffeinhaltiges Medikament die Leistung von Profiradfahrern, während die Leistung der Radfahrer, die dachten, sie hätten stattdessen ein Placebo-Medikament erhalten, sich sogar verschlechterte. In Wahrheit hatten beide Gruppen Placebos bekommen. Und Personen, die glaubten, ihr Gentest hätte eine günstige Veranlagung für körperliche Leistungsfähigkeit offenbart, fühlten sich in der Folge fitter und hielten länger auf dem Laufband durch. Die vermeintlich günstigen Gene wirkten sich nicht nur positiv auf die Motivation, sondern auch auf körperliche Messgrössen für die Leistungsfähigkeit wie die Kohlendioxid-Sauerstoff-Austauschrate aus. So beziehen sich Placeboeffekte sowohl in der Medizin als auch im Sport nicht nur auf die eigene Wahrnehmung, etwa indem die Aktivität als weniger schmerzhaft oder anstrengend empfunden wird, sondern sie können körperliche Phänomene wie den Stoffwechsel messbar beeinflussen.


Sportlicher dank Placebo: Radsportler, die dachten, ein Koffein-Medikament zu erhalten, zeigten danach eine bessere Leistung.
Placeboeffekte bei McDonalds
Auch in der Werbebranche weiss man um die Wirkung von Placebos. «Marketing-Placeboeffekte», also dass Erwartungen an bestimmte Produkte die Konsumerfahrung beeinflussen, sind seit gut 50 Jahren Gegenstand der Forschung. So kann die Verpackung, insbesondere das auf einem Produkt aufgedruckte Label die Geschmackserfahrung stark beeinflussen. Dieser Marketingeffekt kann so weit gehen, dass Kinder Gemüse, das mit dem McDonalds-Etikett versehen ist, als besser schmeckend einstufen als dasselbe Gemüse ohne dieses Label – wie eine Studie mit US-amerikanischen Kindern im Vorschulalter aus dem Jahr 2007 zeigte.
Und auch beim Marketing-Placebo geht die Wirkung über eine rein subjektive Veränderung der Wahrnehmung hinaus: Produktinformationen und damit herbeigeführte Erwartungen können auch körperliche Veränderungen hervorrufen und zum Beispiel die Ausschüttung von Hormonen beeinflussen. So geschehen in einer Studie aus dem Jahr 2011, in der die Probanden einen identischen Milchshake, allerdings mit unterschiedlichen Angaben, gereicht bekamen. Die eine Gruppe glaubte, einen hochkalorischen Milchshake zu trinken, während die andere Gruppe annahm, einen Milchshake zu schlürfen, der weniger als die Hälfte der Kalorien eines normalen Shakes enthielt. Die Blutproben, die man den Studienteilnehmern nach dem Genuss des Milchgetränks abnahm, offenbarte Erstaunliches: Hatten die Probanden die Information erhalten, einen Milchshake mit hohem Kaloriengehalt zu trinken, führte dies zu einem Absinken des Ghrelinspiegels, was im Normalfall mit einer Appetitzügelung und einem Sättigungsgefühl einhergeht. Bei jenen Probanden, die dachten, einen niedrigkalorischen Milchshake erhalten zu haben, veränderten sich die Werte hingegen nicht. Die Vorabinformation über den Kaloriengehalt von ein und demselben Getränk hatte tatsächlich den Ghrelinspiegel und dam it wohl auch die Sättigung beeinflusst.
Ob nun beim Essen, im Sport oder beim Auskurieren einer Krankheit, den abschätzigen Satz «Das ist doch nur Placebo!» werden Sie aus meinem Mund bestimmt nie wieder hören. Und der nächste Salat, den ich esse, wird eine richtige Kalorienbombe sein – zwar nur eingebildet, aber auch das macht satt. Placeboeffekt sei Dank!